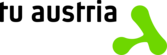Sichere Batterien für unseren sicheren Alltag

Batterien sind essentieller Bestandteil unseres Alltags und zentrales Element einer nachhaltigen Umwelt. Wollen wir großflächig auf erneuerbare Energiequellen umsteigen, deren Bereitstellung wie bei Wind und Sonnenkraft schwankt, dann müssten wir den grün gewonnenen Strom lang- und kurzfristig zwischenspeichern. Eine Möglichkeit sind Batterien in unterschiedlichen Größenordnungen. Die Technologie ist nicht neu und bereits heute weit verbreitet eingesetzt. Aber in je mehr Anwendungsgebieten sie eingesetzt werden und je höher ihre Leistungen vor allem in Alltagsanwendungen wie Mobilität werden, desto höher sind auch die Ansprüche an die Sicherheit. Hier forscht die TU Graz an unterschiedlichen Instituten und Forschungszentren.
Battery Safety Center
Batterien stauchen, gegen Wände fahren lassen, drücken, quetschen und auf andere Arten bis zum Versagen belasten – das macht das Battery Safety Center an der TU Graz. Ziel ist es, die Grenzen der Belastbarkeit einer Batterie unter unterschiedlichen Umweltbedingungen auszuloten und exakte Kennzahlen festzumachen. Dies geschieht mit geladenen oder ungeladenen Batterien in unterschiedlichen Altersklassen und mit diversem „Vorleben“ – also unterschiedlichen Belastungen in ihrer aktiven Zeit.
Im nächsten Jahr kommt im Zentrum ein neuer Prüfstand dazu, der besonders im Bereich der mechanischen Belastung und Batteriecharakterisierung neue Forschungserkenntnisse bringen wird. So setzen Forschende unter anderem Batterien ganz gezielt unter Druck , um etwa den Zustand in einem Batterypack in einem E-Auto zu simulieren. So vorbereitet können die Batterien dann be- und entladen werden oder auch elektrische Kenngrößen ermittelt werden, um die Auswirkungen zu untersuchen. „Aber wir können damit noch viel mehr testen. Dank eines ausgeklügelten Messsystems und Prüfstandskonstruktion erreichen wir auch eine sehr hohe Messgenauigkeit, die jene unserer aktuellen Prüfstände um ein Vielfaches übersteigen wird und wir noch präzisere Daten für unserer Simulationsmodelle generieren“, sagt Jörg Moser, der das Zentrum leitet.
Video starten
Battery4Life
Ziel des Comet-Zentrums Battery4Life ist es, Batterien langfristig sicher nutzbar zu machen – der Fokus liegt dabei auf Lithium-Ionen-Batterien. Im Zentrum wird auf unterschiedlichen Ebenen geforscht: Im Bereich Analyse und Optimierung wird das Verhalten von Energiespeichern unter hohen Belastungen erforscht. Darüber hinaus wird ein genauer Blick auf die Degradierung, also Alterung von Batterien, geworfen und dabei vor allem untersucht, wie sich das Alter auf die Sicherheit im Betrieb auswirkt. Zentral für den sicheren langfristigen Betrieb, im ersten und zweiten Leben ist auch eine kontinuierliche Überwachung der Batterien. Am Zentrum sollen dafür neue Messverfahren und Qualifizierungsmethoden entwickelt werden. Zusammengefasst geht es den Forschenden um einen multi- und interdisziplinären Ansatz zur Batteriensicherheit.
T-Cell-Dummy
Die Sicherheitsvorkehrungen an Forschungseinrichtungen wie dem Battery Safety Center sind natürlich enorm, werden dort doch Batterien bis an ihre Grenzen getestet. Dort dreht sich alles um die Batterie selbst, aber Batterien sind auch in anderen Forschungsgebieten relevant, wenn auch nicht zentral. Damit zum Beispiel Kühlsysteme funktionieren, muss die Wärmeentwicklung in einer Batteriezelle oder einem Batterypack beachtet werden. Am Institut für Thermodynamik und Nachhaltige Antriebssysteme wird genau für solche Fälle an einem T-Cell-Dummy geforscht. „Es ist eine klassische Rundzelle, die im Inneren aber nur aus einer Heizfolie und Elektronik besteht“, erklärt Eberhard Schutting, der das Projekt leitet. „Damit können wir die Wärmeentwicklung simulieren, schalten aber die Gefahrenquellen aus, die bei grenzwertigen Belastungen zu einer chemischen Reaktion und einem Brand führen können.“ Die Oberfläche des Zell-Dummys erhitzt sich wie die einer herkömmlichen Batterie. Gekoppelt mit einer ausgeklügelten Simulation, die am Prüfstand im Hintergrund läuft, kann so der Betrieb exakt nachgebildet werden.
Institut für Prozess- und Partikeltechnik erforsch Thermal Runaway
Der Thermal Runaway ist ein unkontrolliertes Überhitzen von Batteriezellen, das eine gefährliche Kettenreaktion auslösen kann. Dabei wird die gespeicherte Energie als heißes Gas und einem Nebel aus winzigen Partikeln plötzlich ausgestoßen. Insbesondere weil Batterien immer leistungsstärker werden und pro Ladevorgang mehr Energie aufnehmen können, ist dieses Thema ein wichtiges. Denn: Je leistungsstärker die Batterie, desto gefährlicher ist ein Thermal Runaway. Der Partikelnebel kann nämlich einen Lichtbogen – also Blitze, ähnlich wie bei einem Gewitter – innerhalb des Batterypacks erzeugen und ein unkontrollierbares Feuer entfachen. Das Institut für Prozess- und Partikeltechnik untersucht dieses Phänomen und Wege, es zu verhindern. Ziel ist es, Ingenieur*innen Simulationstools, neue Testmethoden, Sicherheitsanweisungen und Guidelines zur Vermeidung von Lichtbögen zur Verfügung zu stellen.
Im Materialinneren
Ebenfalls am Institut für Prozess- und Partikeltechnik werden die Materialien untersucht, die in Batterien verbaut sind, um genauere Einblicke in deren Verhalten zu gewinnen. In einem Projekt etwa werden Methoden untersucht, um die Bewegung und das Fließverhalten von unregelmäßig geformten Partikeln, wie sie in Batterien und Batterierecyclingprozessen vorkommen, zu simulieren. Für die Simulation dieser Partikel wurde nach einer Form gesucht, die ihnen und ihrem Verhalten am ehesten entspricht – gefunden wurden der sogenannte Tetrapod, der anschaulich nachbildet, wie sich nicht-runde Partikel beim Fließen verkeilen oder verhaken. Das ist vor allem im Recycling von Batterien relevant.
Am Institut für Materialphysik werden ebenfalls die Materialien in Batterien untersucht. Insbesondere will man Einblicke in die Be- und Entladungsprozesse in Lithium- und Natriumionenbatterien gewinnen und setzt dafür magnetische Messmethoden ein. Hierbei macht man sich zunutze, dass die typische Kathode einer solchen Batterie aus einem Übergangsmetalloxid besteht, das beim Be- und Entladen oxidiert oder reduziert wird. Diese elektrochemischen Vorgänge können mit einem sogenannten Magnetometer in einem speziell entwickelten Messaufbau empfindlich verfolgt werden.
Mehr Sicherheit
Gemeinsam sorgen die unterschiedlichen Forschungsansätze und Projekte für mehr Sicherheit bei unseren Stromspeichern.
Video starten
TU Graz research monthly
Monatlicher Newsletter rund um aktuelle Forschungsthemen an der TU Graz. Jetzt abonnieren: