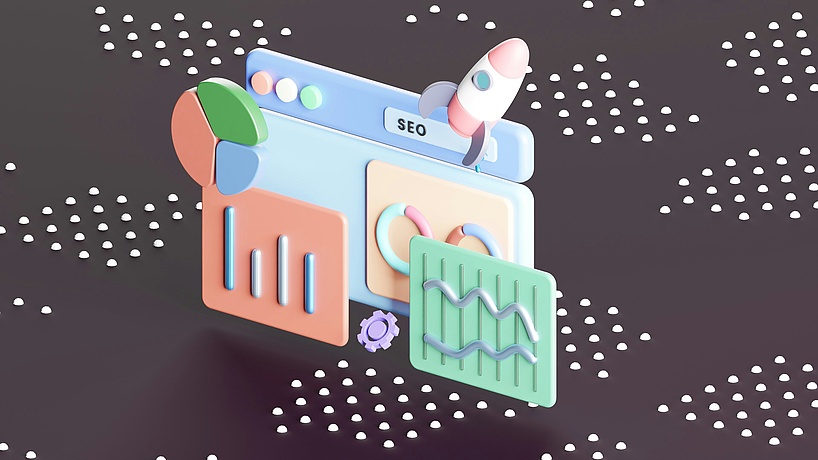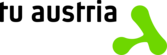Die Sichtbarkeit Ihrer Forschungsergebnisse können Sie selbst optimieren. Ein Teil dieser Strategie sollte Academic Search Engine Optimization (kurz: ASEO) beinhalten. ASEO beinhaltet die erleichterte Auffindbarkeit Ihrer Publikationen durch optimal gewählte Titel, Schlagwörter und Abstracts.
Was ist ASEO?
ASEO ist die Optimierung der Auffindbarkeit eines Papers durch bewusstes „Wording“ in Titel, Schlagwörtern und Abstract. Dabei handelt es sich keineswegs um eine Manipulation der Suchfunktion in Datenbanken und Bibliothekskatalogen. Der Artikel soll nur dort sichtbarer werden, wo er auch relevant ist. Das bedeutet im Detail, dass er durch eine genauere Indexierung besser gefunden und als relevant identifiziert werden kann. Dadurch erhöht sich seine Sichtbarkeit, was sich direkt auf die Häufigkeit der Zitationen auswirkt. Sowohl für die Autorinnen und Autoren der Publikation, als auch für Forschende, die eine Recherche zu einem bestimmten Thema durchführen, kann dies viele Vorteile bringen.
Wie funktioniert ASEO?
Das Prinzip für ASEO liegt in der Funktionsweise von (wissenschaftlichen) Suchmaschinen: Forschende recherchieren nach relevanten Artikeln in unterschiedlichen Systemen wie Bibliothekskatalogen, Datenbanken, Google Scholar, Academic Social Networks sowie Literaturverwaltungsprogrammen, indem sie diese mit Suchbegriffen, Schlagwörtern, Namen von Autorinnen und Autoren u. Ä. füttern.
Diese Systeme suchen nach den eingegebenen Begriffen in den Metadaten und Abstracts der dort verzeichneten Artikel. Wird der Begriff an einem dieser Orte gefunden, erhält man einen Treffer. Die meisten Datenbanken und ähnliche Systeme sind zudem sogenannte „Discovery-Systeme“, die ihre Ergebnisse nach Relevanz reihen. Diese Relevanz setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen. Zwei davon, auf die auch die Autorinnen und Autoren Einfluss nehmen können, sind Ort und Häufigkeit des gesuchten Begriffes. Das bedeutet, dass die Sichtbarkeit nicht nur durch die richtigen Begriffe gesteigert wird, sondern auch durch ihre Positionierung an der richtigen Stelle und mehrfache Erwähnung innerhalb eines Datensatzes. Denn je höher der Artikel in der Ergebnisliste angezeigt wird, desto sichtbarer ist er.
Ausgestattet mit diesem Wissen haben Forschende die Möglichkeit, die Auffindbarkeit ihrer Artikel durch gezieltes „Wording“ auf drei Ebenen zu verbessern: Titel und Untertitel, Schlagwörter und Abstracts.
Optimierung der Titel
Der ideale Titel ist kurz, aussagekräftig und beinhaltet den Schlüsselbegriff der Forschungsarbeit. Ausdrücke wie „die Wirkung von“, „die Beteiligung von“ oder „der Nachweis von“ sollten vermieden werden, da sie den Titel verlängern und gleichzeitig die Lesbarkeit verringern. Titel sollten immer genau das Thema beschreiben, um auch ohne Kontext – beispielsweise ein Sonderheft zum Forschungsgebiet – und als alleinstehende Publikation zu „funktionieren“.
Das Wichtigste steht immer an erster Stelle: Der Schlüsselbegriff der Forschungsarbeit sollte bereits in den ersten 65 Zeichen des Titels verwendet werden. Insbesondere die deutsche Grammatik verleitet dazu, den wichtigsten Teil des Satzes an den Schluss zu stellen. Aus der Sicht von ASEO ist das problematisch, kann aber leicht vermieden werden. Durch das Umdrehen des Satzes können Leserinnen und Leser das Thema des Artikels sofort erfassen, was vor allem bei einer hohen Trefferquote bei der Literaturrecherche hilfreich sein kann. Statt beispielsweise „Die wichtigsten Fragen und Probleme rund um ASEO“ als Titel zu wählen, ist es für Mensch und Maschine besser, den relevanten Schlüsselbegriff – „ASEO“ – an den Anfang des Satzes zu bringen: „ASEO und seine wichtigsten Fragen und Probleme“.
Besonderes Augenmerk sollte auf die Vermeidung von Sonderzeichen gelegt werden. Bindestriche zwischen Wörtern werden beispielsweise nicht als Wortzusammensetzungen erkannt. So ist es nicht empfehlenswert „Hydro- und lipophil“ im Titel zu verwenden, da durch die Trennung von „hydro“ und „phil“ das Wort „hydrophil“ von der Suchmaschine nicht als solches erkannt wird. Der Artikel wird daher bei der Suche nach „hydrophil“ nicht in der Trefferliste aufscheinen. Auch ein Doppelpunkt innerhalb eines Titels kann problematisch sein. Da Untertitel von manchen Systemen automatisch durch Trennzeichen wie Doppelpunkte ersetzt werden, verdoppeln sich auf diese Weise die Sonderzeichen und der Titel verliert an Klarheit. Auch Verlage missverstehen Doppelpunkte oft als Trennung von Titel und Untertitel. Dadurch kann ein Teil des Titels unbeabsichtigt zum Untertitel werden. Eine Studie zu Bindestrichen in Titeln wissenschaftlicher Publikationen weist zudem nach, dass Bindestriche im Titel zu weniger Zitationen führen können.[1] Der Grund liegt in der erhöhten Fehleranfälligkeit beim Zitieren, da hier bei Fehlern das Zitat nicht der Publikation zugeordnet werden kann. Die Publikation wird also nicht tatsächlich weniger oft zitiert, aber die gezählten Zitationen verringern sich dadurch. Dieselbe Studie verweist aber auch darauf, dass Veröffentlichungen mit vielen Bindestrichen seltener in High-Impact-Journals publiziert werden.
Nicht alle Suchsysteme haben eine Textcodierung, die Formeln und Sonderzeichen ermöglichen. Formeln und Symbole müssen daher in einer einfachen Textcodierung wiedergegeben werden können, um auffindbar zu sein.
Kreative Titel führen zu einer schlechteren Auffindbarkeit, da sie relevante Schlüsselbegriffe meist erst im Untertitel enthalten. Begriffe aus Untertiteln werden allerdings als weniger relevant eingestuft, wodurch die Publikation viel weiter unten in der Trefferliste angezeigt wird. Da Untertitel in Suchsystemen zudem ausgeblendet sein können, lässt man die Leserinnen und Leser mit einem kreativen Titel durch den fehlenden Zusammenhang mit dem Suchbegriff im Dunkeln stehen. Weder Maschine noch Mensch können auf diese Weise den eigentlichen Inhalt identifizieren.
Um die Sichtbarkeit Ihrer Publikation nicht zu beeinträchtigen, sollte auf gegenderte Begriffe im Titel (Binnen-I, Sternchen* und Gender Gap) verzichtet werden. Auch hier können die Suchsysteme den Wortzusammenhang nicht erkennen. Wählen Sie daher vorzugsweise geschlechtsneutrale Formulierungen oder schreiben Sie beide Varianten aus.
Abkürzungen sollten ebenfalls nicht verwendet, oder zumindest an anderer Stelle – zum Beispiel im Abstract – in ihrer ausgeschriebenen Form, da ansonsten bei der Suche nach der ausgeschriebenen Form Ihre Publikation nicht gefunden werden kann. Bedenken Sie außerdem, dass es Abkürzungen gibt, die in unterschiedlichen Fächern andere Bedeutungen haben können.
Optimierung der Abstracts
Da Abstracts meist frei zugänglich sind, bilden sie zusammen mit dem Titel den meistgelesenen Teil Ihrer Publikation. Die Kurzzusammenfassung ist häufig ausschlaggebend dafür, wie oft der Beitrag von Leserinnen und Lesern gedownloadet wird. Gleichzeitig bilden Abstract und Titel die Grundlage für den Algorithmus von Suchsystemen, der nach relevanten Keywords sucht, um die Publikation richtig einzuordnen. Daher ist es auch hier wichtig, den Text sowohl für Mensch als auch Maschine ansprechend zu gestalten. Die Bedeutung der Abstracts für die Auffindbarkeit der Publikation ist vor allem seit der Einführung von KI-Suchassistenten gestiegen, da diese hauptsächlich nach den Abstracts und den Metadaten filtern. Volltexte werden von der KI selten hinzugezogen.
Erwähnen Sie in Ihrem Abstract das Wichtigste zuerst. Dabei handelt es sich um die wesentlichen Ergebnisse und Schlussfolgerungen Ihrer Publikation. Das ist unter anderem auch deshalb relevant, weil nicht jede Datenbank Abstracts vollständig anzeigt. Formulieren Sie zudem die Schlüsselpunkte in einfacher Sprache und verwenden Sie kurze Sätze und direkte Aussagen.
Aus ASEO-Sicht ist es zudem essentiell, Synonyme und Überbegriffe im Abstract zu verwenden. Damit decken Sie ein breites Spektrum an möglichen Suchbegriffen ab, die Ihre Leserinnen und Leser zum Thema verwenden können. Es ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass nicht alle nach denselben Stichworten suchen werden.
Wiederholen Sie die relevanten Keywords mehrmals, um Suchmaschinen anzuzeigen, dass Ihre Publikation eindeutig diesem Themenfeld zuzuordnen ist. Hier ist jedoch Mäßigung geboten, denn zu viele Keywords, die den Text zudem unleserlich machen, werden von Suchsystemen mit einer schlechteren Platzierung in der Trefferliste „bestraft“.
Inhaltlich muss das Abstract natürlich kohärent und leserlich bleiben. Opfern Sie nicht Professionalität für die perfekte ASEO.
Optimierung der Schlagwörter
Schlagwörter sollen im Gegensatz zum Abstract indikativ sein. Das bedeutet, dass sie nicht das Ergebnis der Studie beschreiben, sondern über den Inhalt Auskunft geben sollen. Die Frage „Worum geht es in der Studie?“ ist dabei zentral. Die Verschlagwortung ist Grundlage für die spätere Kategorisierung Ihrer Publikation in verschiedenen Umgebungen. Oft liegt es außerhalb des Einflussbereichs der Autorinnen und Autoren, welche Schlagworte vergeben werden, da diese als Metadaten zur Publikation oft von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren oder Verlagen hinzugefügt werden. Dennoch kann sich die Möglichkeit ergeben, die Schlagwörter zu Ihrer Publikation selbst zu vergeben. Hier bietet es sich an, die Sichtbarkeit via ASEO zu steigern, indem man treffende Schlagwörter vergibt, die dann von Suchsystemen ausgewertet werden.
Für die Schlagwortauswahl sind folgende Kategorien von Relevanz: Person, geografische und zeitliche Einordnung, Thema und Form (Bildband, Studie, Umfrage, Methode, usw.). Nehmen Sie auch hier die Perspektive der Suchenden ein und fragen Sie sich, mit welchen Schlagworten diese recherchieren könnten. Vermeiden Sie nichtssagende Wörter wie „Vergleich“, „Charakterisierung“, „Kritik“ und ähnliche Formulierungen. Stimmen Sie die Schlagworte mit dem Titel ab. Idealerweise nehmen Sie im Titel eine sehr spezifische Einordnung ihres Themas vor und mit den Schlagwörtern eine breitere. Auf diese Weise wird Ihre Publikation von einem größeren Benutzerspektrum aufgefunden. Hier können Sie auch Oberbegriffe zu ihrem Thema nutzen. Um passende Oberbegriffe zu finden, ist die Recherche in Thesauri empfehlenswert. Probieren Sie die Schlagwörter selbst in einer Suchmaschine aus und überprüfen Sie, ob sie mit dem Themenfeld zufrieden sind, in dem Ihre Publikation mit dieser Verschlagwortung zu finden sein wird. Stimmen Sie enge und breitere Begriffe ab, um zu vermeiden, nur mit zu spezifischen oder zu weiten Suchabfragen gefunden zu werden.
Bedenken Sie außerdem, dass Schlagworte grundsätzlich in der Einzahl und nicht dekliniert anzugeben sind.
Weitere Optimierungen, die sich lohnen
Grafiken, Bilder und Tabellen
Um Ihre Grafiken und Bilder ASEO-fit zu machen, speichern Sie diese als Vektorgrafiken ab. Wählen Sie daher am besten .svg, .eps oder .ai als Dateiformat und vermeiden Sie .jpg, .bmp und .png. Der Grund dafür liegt in der Maschinenlesbarkeit von Vektorgrafiken. Dadurch können die darin enthaltenen Daten für ASEO nutzbar gemacht werden.
Auch die Dateieigenschaften eignen sich zur Optimierung: Alternativtexte, Bildunterschriften und Texte in Tabellen werden von Suchmaschinen beachtet. Versehen Sie diese Texte mit wichtigen Schlagwörtern, passend zu Ihrer Forschungsarbeit und den dargestellten Inhalten. Bilder werden auf diese Weise auch über die Bildersuche leichter gefunden.
PDFs
Auch die Metadaten von PDFs können von Ihnen verändert werden, damit die Datei besser auffindbar ist. Fügen Sie der Datei Titel, Verfasserinnen und Verfasser sowie Schlagwörter hinzu. Die PDFs und deren Dateieigenschaften können daraufhin von Suchmaschinen indexiert werden.
Wenn Sie das PDF aus einer Word-Datei generieren, beachten Sie, dass Word automatisch den Usernamen ins Feld „Verfasser“ einträgt. Beim Abspeichern kann dieser auch in das PDF gelangen. Kontrollieren Sie daher immer das Feld „Verfasser“, damit derjenige Name vermerkt ist, unter dem Sie Ihre Forschung veröffentlichen und nicht ein unerwünschter Username.
Struktur der Publikation
Suchmaschinen erkennen auch Strukturen von wissenschaftlichen Artikeln. Sie können beispielsweise Zwischenüberschriften und Referenzen auslesen. Daher steigert es die Sichtbarkeit Ihrer Publikation, wenn Sie Keywords in die Zwischenüberschriften einbringen. Die Umschreibung wichtiger Schlagwörter in den Überschriften ist daher eher zu vermeiden. Dadurch wird die Inhaltsanalyse der Suchsysteme verbessert und Ihr Artikel leichter gefunden.
Gute wissenschaftliche Praxis: Grenzen der ASEO
Wichtiger als die Sichtbarkeit Ihrer Forschung zu steigern ist deren Integrität. Achten Sie daher auf ein Gleichgewicht zwischen der Erhöhung der Visibility durch ASEO und der Präsentation relevanter, qualitativ hochwertiger Forschung. Die Qualität Ihrer Forschung und Ihr akademischer Ruf sollten nie für die Optimierung der Auffindbarkeit gefährdet werden. Überoptimierung ist zudem nicht nur schädlich für Ihre Publikation, sondern wird auch von Suchmaschinen und Leserinnen und Lesern „bestraft“.
Acknowledgements
Dieser Blogbeitrag beruht auf dem Workshop „ASEO – Mit Academic Search Engine Optimization zu mehr Sichtbarkeit“ von Lisa Schilhan. Sie ist Abteilungsleiterin der Publikationsservices der Universitätsbibliothek Graz. Wir bedanken uns für die Zurverfügungstellung des Workshopmaterials und -inhalts.
Weiterführende Literatur
Schilhan, L., Kaier, C., & Lackner, K. (2021). Increasing visibility and discoverability of scholarly publications with academic search engine optimization. Insights: The UKSG Journal, 34(1), 6. https://doi.org/10.1629/uksg.534
Literaturverzeichnis
[1] Zhou, Z.Q., Tse, T.H. & Witheridge, M. (2019), “Metamorphic Robustness Testing: Exposing Hidden Defects in Citation Statistics and Journal Impact Factors.” IEEE Transactions on Software Engineering, 2019, 1. https://doi.org/10.1109/TSE.2019.2915065