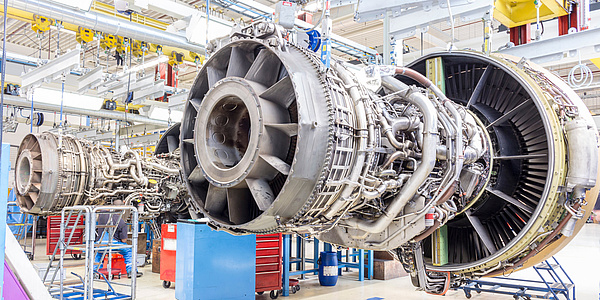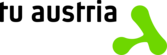Talk Science to Me #52: Beton mit Klettverschluss
Dieser Text ist ein Transkript der Podcast-Folge und wurde im Sinne der Verständlichkeit leicht angepasst.
Herzlich willkommen bei Talk Science to Me, dem Wissenschaftspodcast der TU Graz. Mein Name ist Birgit Baustädter und heute spreche ich mit Matthias Lang-Raudaschl. Er arbeitet an einem Beton, der wie ein Klettverschluss funktioniert und so einfache Montage und Demontage möglich macht.
Lieber Matthias, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du heute mit mir über das Thema Beton sprichst. Du bist kein Betontechnologe, aber in deiner Arbeit spielt Beton auch eine Rolle. Deswegen wäre es toll, wenn du mir kurz erzählen könntest, was du tust, woran du forschst und wie deine Verbindung zu Beton ist in der Arbeit.
Matthias Lang-Raudaschl: Ja, danke für die Einladung und sehr gerne. Also grundsätzlich forschen wir an unterschiedlichen Themen, unterschiedlichen Materialien, aber Beton war natürlich früher am Institut ein großer Fokus auch durch den ehemaligen Leiter Roger Riewe. Aber das Interesse von meiner Seite war auch immer da, an dem Material zu forschen, weil es einfach sehr viel zulässt, auch sehr einfach herzustellen ist und die Möglichkeiten einfach sehr groß sind und auch in der Forschung viele Themen ungelöst sind.
Du bist am Institut für Architekturtechnologie. Abseits von Beton, was ist so der Forschungsalltag? Woran arbeitest du?
Lang-Raudaschl: Es ist im Grunde sehr unterschiedlich und sehr breit gestreut. Es ist von Materialthemen wie Beton bis hin zu Bauprozessen bis hin zur Digitalisierung eigentlich sehr, sehr breit, sehr umfassend. Das Überthema ist immer das Rückbaufähige oder die Kreislauffähigkeit. Und hier gibt es einfach unterschiedliche Themen, die mich interessieren oder die uns am Institut auch interessieren und wo auch schon viel Know-how da ist. Es ist auch beim aktuellen Projekt ReCon so, dass es von der Fügetechnologie bis hin zu den Bauteildaten reicht und da geht es zum Beispiel auch darum, dass wir die Daten überlegen oder definieren, die man bräuchte, um ein Gebäude später wieder rückbauen und wieder einsetzen zu können. Also welche Daten beim Bauteil brauche ich wirklich? Im Sinne von Mindestdaten, aber auch im Sinne von Maximum, was ist so möglich in einer Cloud zum Beispiel. Und das Ganze auch als Prozess abgebildet. Also auch: Wie geht man ins Gebäude rein, wo bekommt man die Information, gibt es eine Leitstelle, ein Info-Terminal sozusagen, wo ich weiß, wo ich weitere Informationen bekomme und wie kann ich es dann wieder rückbauen und wieder einsetzen? Solche Daten sind zum Beispiel, wer hat es hergestellt, wann wurde es hergestellt, gewisse Festigkeit oder andere Eigenschaften des Bauteils.
Warum ist diese Rückbaufähigkeit so wichtig? Dieses Thema taucht immer wieder auf und man denkt sich, ich baue ein Gebäude, ich weiß, was ich damit erreichen will. Warum muss ich das rückbauen können?
Lang-Raudaschl: Also im Grunde ist das Bestreben die möglichst lange Nutzung von Bauteilen. Wenn man schon Energie reingesteckt hat in die Herstellung und in den aufwändigen Prozess, das zu transportieren und einzubauen, dass man diese Energie auch bestmöglich und langlebig, so lange wie möglich nutzt. Und auch weil wir ein großes Ressourcenproblem auf der Erde haben, dass wir nicht für alle Menschen so bauen können, wie wir gerne würden. Und dafür braucht es einfach die Rückbaubarkeit, weil auch wenn man es recyceln würde, also runterbrechen und recyceln würde, hat man oft eine Vermengung von Stoffen, die man nicht gut trennen kann, und auch der Aufwand ist viel höher. Also das Einfachste wäre ein Ausbau und ein direkter Wiedereinbau, weil das Bauteil vielleicht noch seine technischen Fähigkeiten erfüllt und auch wieder eingesetzt werden kann.
Und wo kommt da der Beton ins Spiel? Wie beschäftigst du dich mit Beton?
Lang-Raudaschl: Also mein Fokus bei Beton ist die Fügetechnologie, also das Rückbauen von Bauteilen, die auf Beton aufgebracht sind oder auf Beton montiert sind. Dazu wenden wir die Klettverbindung an. Wir sind auf die Klettverbindung beim Vorgängerprojekt gestoßen und fanden sie sehr spannend und sehr gut für die Rückbaubarkeit. Haben dann einerseits versucht, den industriellen Klett auf Beton aufzubringen und haben den Rohstoffbeton an sich so ausgebildet, dass er klettfähig wäre. Damit ich direkt mit Anpressen gleich eine Verbindung herstellen kann und Objekte montieren kann.
Ich kenne Klett von Klettverschlüssen, also zum Beispiel bei Kleidung oder bei Rucksäcken. Das sind so kleine Häkchen, die sich ineinander festhalten, mehr oder weniger. Schaut das beim Beton gleich aus oder wie funktioniert es da zu kletten?
Lang-Raudaschl: Genau, es besteht immer aus zwei Komponenten oder zwei Verbindungspartnern. Ein Element ist ein Schlaufen-Element und das Gegenstück ist ein Haken oder Pilzkopf. Was auch möglich ist, sind zwei Pilzköpfe, die auch ineinandergreifen. Und beim Beton haben wir das übersetzt oder habe ich das in meiner Dissertation übersetzt und wir haben es in Folgeprojekten dann fortgeführt. Und zwar dadurch, dass der Beton in Haken oder Pilzköpfen ausgebildet wird. Das bedeutet, er wird besonders geschalt, also in einer besonderen Geometrie geschalt, dass er Hinterschneidungen aufweist oder kleine Klettelemente entstehen, die in der Schneidung aufweisen und es dadurch ermöglichen, dass ein Gegenstück eingreift und sich direkt an der Oberfläche befestigen lässt.
Wie fertige ich das?
Lang-Raudaschl: Also die Fertigung von Klettbeton funktioniert über besondere Schalungen und da wird die Wachsschalung ausgewählt, weil sie es ermöglicht, dass ich das Schalobjekt, also die Schalung selbst herauslösen kann, ohne dass ich den Beton dabei zerstöre. Weil durch die Unterschneidung ist es nicht möglich, eine herkömmliche Schalung zu verwenden, weil ich die Klettelemente herunterreißen, also zerstören würde. Also ich brauche eine Schalung, die ich herauslösen kann und das ist bei der Wachsschalung einfach sehr gut möglich, durch Temperatur zum Beispiel. Ich kann die Wachsschalung formen, den Beton eingießen und dann die Wachsschalung wieder entfernen und übrig bleiben die Klettelemente.
Beim Klettverschluss ist das ja was Elastisches, das man aneinander fügt und wieder trennen kann. Wie ist das beim Beton? Der kann jetzt nicht elastisch sein und irgendwie so angebracht werden. Wird das ineinander geschoben oder wie geht das?
Lang-Raudaschl: Da ist auch das Gegenstück elastisch, weil ich sonst wieder das Problem hätte, dass ich es zerstöre und weil ich auch hier immer die kürzere Langlebigkeit habe. Beim Klettbeton ist auch die Idee, dass die Klettverbindung so lange lebt, wie das Bauteil selbst lebt, also idealerweise bis zu 150 Jahre oder mehr. Und das Gegenstück wird früher ausgetauscht. Es hat eine kürzere Lebensdauer. Und dadurch kann ich es einfach an der Fläche aufpressen und habe auch die Flexibilität, dass ich überall montieren kann, wo ich will. Kann es aufpressen und dadurch schnappt es ein, ist elastisch und an einer Ecke kann ich es wieder angreifen und wieder runterlösen und kann es so wieder rückbauen.
Welche Elemente wären das zum Beispiel, die sich da eignen?
Lang-Raudaschl: Am idealsten sind die Anwendung, wo ein hoher Installationsgrad ist, also ein hoher Wechsel an Bauteilen über die Lebensdauer des Gebäudes. Und das ist bei uns die technische Gebäudeausrüstung. Das ist so das Paradebeispiel. Weil ich hier oft Installationsleitungen habe, die ich dann austauschen muss oder ich rüste mein Gebäude nach und habe neue Elemente, die ich anbringen muss. Und ein weiterer Vorteil ist, dass es auch eher punktuelle Befestigungen sind, also punktuelle Befestigungen von einem Lüftungsrohr zum Beispiel, also die Rohrschelle, oder von einer anderen Leitung. Weil ich hier auch den Vorteil der Klettverbindung gut ausnutzen kann, dass ich sie punktuell befestige und punktuell diese Last aufbringe.
Es gibt ja bisher schon Methoden, solche Leitungen zu montieren. Und welche Vorteile habe ich jetzt damit, aber auch welche Nachteile?
Lang-Raudaschl: Beim Beton ist der große Vorteil, dass ich die Befestigung sehr einfach herstellen kann. Der Montageprozess wird viel leichter. Ich muss, vor allem wenn es Überkopfbefestigung ist, nicht vorbohren und dann über Kopf
befestigen und schrauben und das Ganze aufwendig ausrichten, sondern ich kann einfach anpressen und die Befestigung ist schon erfolgt. Und ein weiterer großer Vorteil ist, dass ich das Bauteil nicht beschädige, also ich greife nicht in das Bauteil nachträglich ein, wenn es hergestellt ist, sondern ich befestige nur ein Element auf der Oberfläche und lasse das Bauteil unberührt.
Brauche ich dafür einen bestimmten Beton?
Lang-Raudaschl: Also der Ansatz ist, dass es mit jedem Beton herstellbar ist, dass man sich da von einem aufwändigen Mischverhältnis löst. Aber man muss ehrlich sein, es ist eigentlich nur der Zementstein, der dann die Klettverbindung ausbildet derzeit. Weil die Gesteinskörnung ist zu grob, ist zu groß, dass sie nicht in die Klettelemente vordringt, sondern es ist dann der Zementstein, der dann diese Klettelemente ausbildet.
Ändert das optisch was am Beton oder an dem Bauteil?
Lang-Raudaschl: Es werden die Klettelemente gut sichtbar, weil wir bis zu Zentimetergrößen arbeiten, von ganz klein bis zu Zentimetergrößen. Ich habe schon eine andere Raumwirkung dadurch. Es wird dann nicht eine glatte Sichtbetonoberfläche, sondern es ist eine lebendigere Struktur. Vor allem auch durch die angebrachten Elemente kriegt es auch eine gewisse Lebendigkeit, das Ganze.
Das heißt, man könnte sich da auch irgendwelche optisch schönen dekorativen Elemente überlegen?
Lang-Raudaschl: Genau, man könnte im Grunde diesen Klett in einer bestimmten Geometrie ausbilden, könnte verschiedene Tiefen einbringen und damit auch die Möglichkeit einer unterschiedlichen technischen Leistungsfähigkeit abbilden. Wir können auch Bereiche abbilden, wo man höhere Lasten aufbringen kann oder geringere Lasten oder wo man eher Dekoration aufbringt oder eher technische Bauteile anbringt.
Aber könnte man dann zum Beispiel auch darüber verputzen oder irgend so was? Ist diese Wand dann gleich verwendbar wie eine herkömmliche Betonwand oder bleibt die dann so unsichtbar?
Lang-Raudaschl: Es ist sichtbar gedacht, damit ich die Trennbarkeit später habe, die Rückbaubarkeit habe und dass man eher davor noch einen Sichtschutz, ein Element aufbringt, aber auch eher in diesem Bereich, wo ein hoher Installationsgrad ist. Also es ist eher die Decke und Gangflächen gedacht, wo viele Leitungen verlaufen. Der ganze Raum aus Klett war immer eine Leitidee, aber da ist die Tauglichkeit ein bisschen fraglich, ob es dann wirklich sinnvoll ist, das überall zu machen.
Warum habt ihr jetzt Beton genommen als Baustoff?
Lang-Raudaschl: Also einerseits Beton, weil da der Vorteil so hoch ist von der Montage her und weil auch die Formbarkeit so gut ist. Im Projekt untersuchen wir auch die Herstellung von Klettholz und Klettpapier. Holz kann ich dann eben sägen oder mit Fräsen bearbeiten und kann diese Klettelemente auch sehr gut ausbilden. Und auch ein großer Vorteil dabei ist wieder, dass ich nicht eingreifen muss in das Bauteil und sehr einfach etwas befestigen kann. Beim Holz gibt es immer diesen starken Konkurrenten, die Schraube. Und die ist einfach sehr, sehr flexibel und sehr einfach anzubringen. Es gibt schon auch Vorteile, aber der Vorteil ist einfach nicht so groß wie beim Beton.
Und Papier, für welchen Ansatz habt ihr das gedacht?
Lang-Raudaschl: Genau, Klettpapier war ein Zusatzthema, eine Ergänzung, dass wir uns das auch auf ganz experimenteller Ebene anschauen, ob man Klett aus Papier herstellen kann. Und wir waren sehr, sehr positiv überrascht über die Festigkeit, die möglich wäre, durch einfaches Papierfalten oder eigentlich Kartonfalten, wobei natürlich die Feuchtebeständigkeit viel geringer ist. Da ist eher ein Herantasten an Möglichkeiten. Wir haben es aber auch als Betonschalung zum Beispiel angesetzt.
Sind solche Beton-Klettteile schon irgendwo eingesetzt worden? Habt ihr das schon getestet? Gibt es das schon irgendwo vielleicht anzuschauen?
Lang-Raudaschl: Noch gar nicht. Vor allem diese Klettbetonelemente, die gibt es nur im Labormassstab. Das wird wahrscheinlich noch länger so bleiben, weil die Herstellbarkeit, die Skalierbarkeit sehr aufwendig ist. Die Herstellung der Schalung ist noch sehr
aufwendig, das passiert eher im kleinen Maßstab und um das zu skalieren, bräuchten wir größere Projekte und größere Power im Grunde.
Wie siehst du die Bereitschaft, dass sowas umgesetzt wird, also aus der Bauindustrie jetzt?
Lang-Raudaschl: Die Bereitschaft bei verschiedenen Ideen ist grundsätzlich immer sehr hoch. Es gibt immer Einzelakteure, die sehr motiviert sind, Dinge der Nachhaltigkeit umzusetzen, aber es scheitert oft an rechtlichen Fragestellungen oder an der Umsetzung auf der Baustelle selbst. Es ist einfach eine sehr, sehr träge Branche. Es ist auch viel Geld und viel Energie investiert in bestehende Prozesse. Es wurden Maschinen eingekauft, es wurde Personal geschult zu bestimmten Themen oder zu bestimmten Fertigungstechniken. Und da ist es eben schwieriger, dass man die Leute oder dass man die Branche mitnimmt und trotzdem Innovation vorantreibt. Das ist immer, vor allem mit Grundlagenforschung, ganz schwierig, dass man da diesen Spagat auch schafft.
Wie realistisch siehst du es, dass das flächendeckend oder nicht flächendeckend, aber breiter als im Labor in absehbarer Zeit eingesetzt wird?
Lang-Raudaschl: Schwierige Frage, auch sehr schwer einzuschätzen. Ich denke, wenn ein Unternehmen darauf anspringt und sagt, sie stellen jetzt eine Vorfertigung her, also stellen eine blinde Schalung her zum Beispiel und legen es dann auf der Baustelle ein und betonieren dann drüber oder stellen ganze Fertigteile damit her, dann wäre es grundsätzlich sehr früh und bald einsetzbar und würde in Gebäuden landen. Die Frage wäre dann wieder die spätere Montage von Elementen, ob dann auch die Personen auf der Baustelle die neue Technologie annehmen und die Elemente so montieren, wie es gedacht ist oder dann doch wieder schrauben, weil sie es einfach gewohnt sind. Das ist ein kultureller Prozess, den man mitgestalten müsste oder mitdenken müsste.
Weil natürlich auch die Gegenteile, nicht nur das Betonbauteil speziell geformt sein müssten, oder?
Lang-Raudaschl: Genau, weil auch die Rohrschale dann anders montiert wird zum Beispiel, die technische Gebäudeausrüstung anders montiert wird, wobei auch hier unser Bestreben ist, dass wir auf die bestehenden Systeme aufbauen, also zwischen Gewindestange und zwischen dem Betonelement ein neues Element entwickeln, was hier diese Lücke schließen könnte und dann die Montage ermöglichen würde.
Seid ihr aktuell in diesem Projekt aktiv oder in diesem Thema?
Lang-Raudaschl: Ja, wir sind jetzt gerade am Abschließen der letzten Berichte, der letzten Themen und dann publizieren und dürfen gerade eine Ausstellung im Technischen Museum in Wien vorbereiten und freuen uns, dass es hoffentlich bald gut weitergeht.
Wie wohnst du eigentlich selbst?
Lang-Raudaschl: Also leider ganz ohne Klett, also gab noch keine Möglichkeit, groß umzubauen. Wir wohnen zu viert mit meiner Frau und meinen zwei Kleinkindern in einem circa 100 Jahre alten Gebäude und hier auf 80 Quadratmeter. Es ist etwas knapp, aber es geht sich noch gut aus. Im Grunde war uns vom Leben her oder auch vom Nachhaltigkeitsgedanken her, immer das Material wichtiger. Die Verwendung von dem, was schon da ist, die Nachnutzung von Gebäuden, die Lebensdauer bestmöglich zu steigern, von dem, was schon da ist und weniger die energetische Performance. Energetisch ist es ja nicht so gut das Gebäude, aber dafür ist einfach die Bausubstanz schon sehr alt und es ist saniert. Diese Langlebigkeit, dieses Nutzen von dem, was schon da ist, ist uns sehr wichtig.
Aber bist du dann selbst auch so der Typ, der zu Hause viel umplant, umgestaltet an dem Wohnraum, der da ist?
Lang-Raudaschl: Grundsätzlich schon. Jetzt habe ich gerade sehr wenig Zeit dafür. Mein Sohn ist ein Jahr, meine Tochter ist drei Jahre und da ist ganz wenig Zeit. Im Kopf denke ich schon an Änderungen oder kleinere Umgestaltungen passieren natürlich, aber das sind eher dann Möbelstücke und nichts Größeres zurzeit.
Was hat dich in die Architektur geführt? Was ist das, wo du sagst, das interessiert dich so sehr, dass du dein Berufsleben dort verbringen möchtest?
Lang-Raudaschl: Im Grunde war das das Handwerk. Ich habe bei meinem Großvater in meiner Jugend sehr viel in der Werkstatt arbeiten, bauen und sehr viel mitwirken dürfen und bin dadurch dann in eine HTL für Möbelbau und Innenraumgestaltung gegangen und dort habe ich aber gemerkt, dass mich das Tischlerhandwerk weniger interessiert, weil es plötzlich so genau sein musste, alles so perfekt sein musste und habe dort die Planung für mich entdeckt und bin dann über die Planung dort ins Architekturstudium gekommen und dort dann über Zufälle eigentlich in die Forschung. Ich habe gemerkt, dass es Forschungsprojekte gibt in der Architektur und habe dort schon als Student mitwirken dürfen und habe dann gedacht, das wäre eigentlich genau was für mich, das wäre genau meine Idee, was ich machen wollen würde, mein restliches Leben. Und habe es auch geschafft, dass ich eben hier eine Position ergattere im Bereich der Forschung.
Und was findest du am Klettbereich so spannend?
Lang-Raudaschl: Im Grunde diese Kombination von einem etwas völlig Alltäglichem mit etwas, wo man einfach nicht daran denkt. Man erwartet nicht, dass es in einem Gebäude eine Klettverbindung irgendwo gibt. Man kennt es vom Turnschuh, man kennt es vom Textilbereich, aber man kennt es nicht, dass hier wirklich schwere Bauteile oder Bauteile, die da 30 Jahre hängen, mit Klett befestigt sind. Und diese Kombination und dieses Ausreizen dieser Verbindung interessiert mich sehr, auch weil es grundsätzlich sonst kaum erforscht wird. Ich weiß sonst niemanden, der daran forscht. Es wird manchmal schon angemerkt, dass es in gewissen Gebäuden eingesetzt wird, aber wenn man danach fragt oder nachrecherchiert, findet man wieder nichts dazu. Dieses Forschungsfeld, das einerseits sehr spannend ist, aber auch noch sehr leer ist, das interessiert mich einfach sehr daran.
Gibt es da Fragestellungen, die du gerne im Laufe deiner Karriere lösen würdest?
Lang-Raudaschl: Ja, vielleicht so eine übergeordnete Forschungsfrage. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass unsere Disziplin so unscharf definiert ist. Was ist generell Architekturforschung oder was sind so unsere Methoden, was ist unsere Stärke, was ist das, was wir wirklich können, wo ist unsere Expertise, das ist eine Frage, die immer ein bisschen herumschwirrt. Was können wir, was sonst niemand kann und sonst im Fokus des rückbaufähigen oder kreislauffähigen Bauens, hier auch eher die Definitionsfrage,
was macht ein rückbaufähiges Gebäude wirklich aus, weil es gibt schon sehr viele Details oder sehr viele Gebäude, die sich das auf die Fahnen heften, doch die Frage ist immer, ist es die Fügetechnologie, ist es die Zugänglichkeit der Fügetechnologie, ist es die Elementgröße, dass man es noch per Hand rückbauen kann oder ist es auch die Technologie an sich, dass sie verständlich ist, auch für Personen, die das Gebäude nicht gebaut haben, die später hinkommen und gibt rd eine Lesbarkeit des Gebäudes. Es sind ganz viele Themen eigentlich noch offen und ich hoffe, dass ich da einen Beitrag leisten kann.
Vielen Dank für das Interview.
Lang-Raudaschl: Gerne, danke für die Einladung.
Vielen Dank, dass ihr in dieser Staffel zugehört habt. Wir hören uns.
TU Graz research monthly
Monatlicher Newsletter rund um aktuelle Forschungsthemen an der TU Graz. Jetzt abonnieren: