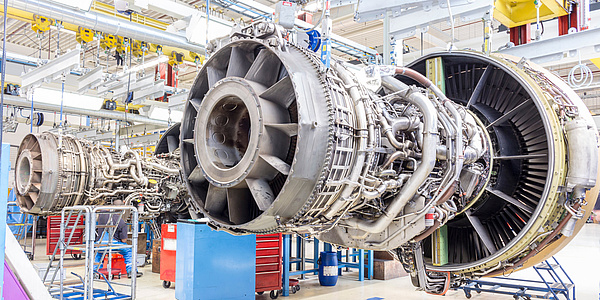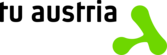Alexander Lex: Wie können Daten besser kommuniziert werden?

Sie haben an der TU Graz studiert, dann in Harvard und Utah wissenschaftlich gearbeitet. Seit einigen Wochen sind Sie wieder zurück an der TU Graz. Was waren beim ersten Wechsel die größten Unterschiede?
Alexander Lex: Man merkt an einer Elite-Universität wie Harvard natürlich, wie viel Geld zur Verfügung steht. Der größte Unterschied lag für mich aber im Druck, mit dem die Forschenden gearbeitet haben. Sie sind unglaublich davon getrieben, erfolgreich zu sein. In der Bostoner Tech-Bubble wurde in jedem Coffee Shop nur über Informatik diskutiert. In meiner Postdoc-Zeit fand ich das persönlich sehr bereichernd, aber auf Dauer wäre mir das zu extrem. In Utah, wo ich anschließend eine Professur angetreten habe, war die Durchmischung der Stadt viel stärker und es drehte sich nicht alles um Technik und Wissenschaft, was einen massiven Unterschied machte.
Gab es in dieser Zeit ein Leben außerhalb der akademischen Welt?
Lex: Nein, während meines Postdocs nicht (lacht). Danach war ich entspannter, auch, weil ich Glück mit Grants und meiner Professur hatte. Ich konnte Studierende anstellen und viele Dinge umsetzen, weil die finanziellen Möglichkeiten gegeben waren. Da gab es dann auch mehr Zeit für mein Privatleben. Was vor allem in Utah für mich als begeisterten Snowboarder toll war. Ich konnte am Vormittag auf die Piste und zu Mittag wieder unterrichten. Es war wunderbar.
Wollen Sie das auch in Graz weiter so halten?
Lex: Das ist in Graz etwas schwieriger (lacht). Aber auch wenn die Entfernung zu den Pisten größer ist, sind die Hotelzimmer in den Skigebieten im Vergleich erschwinglich. In den USA ist das ein Luxus.
Wenn wir zurück zu ihrer Arbeit gehen: Wofür begeistern Sie sich wissenschaftlich?
Lex: Vor allem für Datenvisualisierung und Computerinteraktion. In diesen Bereichen sind meine Interessen sehr breit. Ich arbeite zu Desinformation, aber auch im medizinischen Bereich, in der Medikamentenentwicklung und Präzisionsdiagnostik. Zu diesen sehr komplexen Problemen gibt es unheimlich viele Daten, die analysiert werden müssen. Rein algorithmische Analysen sind dabei zwar toll, aber nicht ausreichend. Die Expert*innen wissen unheimlich viel über den Kontext der Daten, den eine automatische Auswertung nicht einbringen kann. Wenn wir nun die Daten gut aufbereiten, dann können Verknüpfungen hergestellt werden, die der Algorithmus alleine nicht schaffen würde.
Warum sind Visualisierungen überhaupt wichtig?
Lex: Als Mensch ist unser visuelles System extrem stark. Wir können zum Beispiel aus einer Tabelle mit vielen Daten wenige Muster erkennen. Haben wir aber ein Bild vor uns mit vielen blauen und wenigen roten Punkten, dann können wir sehr schnell und ohne Denkaufwand erkennen, wo die roten Punkte liegen und wie viele es ungefähr sind. Das machen wir uns zunutze, um Daten zugänglich zu machen. Wir sehen auch, wie wichtig Visualisierung in der Kommunikation ist. Zum Beispiel nutzen Journalist*innen Grafiken um Wahlergebnisse oder Wählerstromanalysen darzustellen. Ich bin immer wieder begeistert, wie viele Ideen aus meiner Community da aufgegriffen werden.
Ist Visualisierung auch ein wichtiges Thema im Bereich Desinformation?
Lex: Ja, ein sehr wichtiges Thema. Forschung im Bereich Desinformation wird meistens auf Basis von Texten und Netzwerken gemacht. Und das ist auch sehr wichtig. Aber gerade bei datengetriebenen Dialogen sind auch die Visualisierungen sehr wichtig. Allgemein werden Social Media-Beiträge eher wahrgenommen, wenn sie Grafiken beinhalten. Grafiken lassen einen Beitrag auch seriöser und faktenbezogener wirken. Wenn ich nur einen Text poste wirkt das ganz anders, als wenn ich meine Daten in einer Grafik darstelle. Das ist sehr interessant, weil wir sehen, dass oft Grafiken aus seriösen Quellen genommen und in einen falschen Kontext gesetzt werden. Eine Gegenargumentation wird dann unheimlich schwer und auch das Fact Checking sehr aufwendig. Wir haben uns die Dialoge angesehen, die daraus entstehen: Es wird dann mit Anektoten auf Fakten reagiert, unvergleichbare Daten verglichen oder Daten aus unverlässlichen Quellen eingeführt. Sehr interessant.
Was hat Sie in dieses Forschungsgebiet geführt?
Lex: Ich habe in der biomedizinischen Visualisierung begonnen an der TU Graz. Dort habe ich zehn Jahre lang geforscht und vor allem Netzwerkvisualisierungen gemacht – von sogenannten biochemical und signaling pathways, die Prozesse in Organismen beschreiben.
Je größere meine Gruppe geworden ist, desto breiter habe ich aber auch meine Forschung aufgestellt. Das ist der große Vorteil, wenn man eine Senior-Position in der Forschung hat und Mitarbeitende aus unterschiedlichen Bereichen engagieren kann. Mich hat aber auch immer schon die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine interessiert. Wie können Computersysteme gebaut werden, damit Menschen möglichst gut mit ihnen umgehen können? Es gibt viele Überschneidungen mit der Psychologie und es hat den Hacker in mir begeistert, dass ich auf der einen Seite qualitativ forschen konnte und auf der anderen Seite mit der Entwicklung von Softwaresystemen sehr viel Engineering dabei war.
Sind das auch Ihre Pläne für die Professur in Graz?
Lex: Ich möchte diese Forschungen auf jeden Fall weiterführen. Aber zusätzlich auch ein weiteres Forschungsfeld aufnehmen, das in unserer Community noch recht jung ist. Es geht um Accessibility von Visualisierungen für Menschen mit Sehbehinderungen. Wir haben da bereits an automatisierten Textbeschreibungen gearbeitet, unterstützt von AI und LLMs. Aber gerade in der Biologie gibt es sehr komplexe Visualisierungen, die mit einer reinen Textbeschreibung nicht erfasst werden können. Unser Ansatz sind 3D-gedruckte Modelle, die vor allem in der Lehre eingesetzt werden können. Wenn diese Basis-Visualisierungen von den Studierenden einmal verstanden worden sind, dann können andere Visualisierungen sehr gut über Textbeschreibungen dargestellt werden. Daran möchte ich auf jeden Fall weiterarbeiten und sehe tolle Kooperationsmöglichkeiten in Graz.
TU Graz research monthly
Monatlicher Newsletter rund um aktuelle Forschungsthemen an der TU Graz. Jetzt abonnieren: