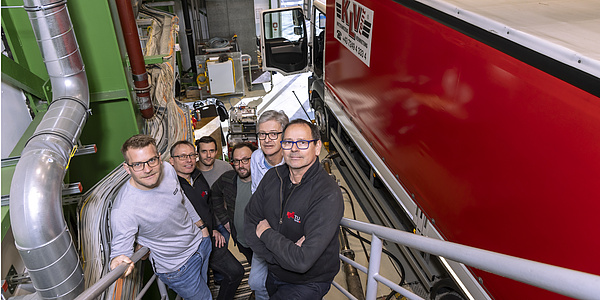„Wir sollten die Hierarchie in der Mobilität neu denken“

News + Stories: Viele Menschen wollen ihr Auto nicht aufgeben, weil sie es brauchen und mögen. Gibt es da Wege, die Leute positiv dazu zu motivieren, auf andere Mobilitätsformen umzusteigen?
Aglaée Degros: Ich habe rund 15 Jahre in Rotterdam gelebt - dort haben die Leute ihre Autos auch nicht aufgegeben. Allerdings steht das Auto am Morgen nicht direkt vor der Tür, sondern in einer Garage etwas weiter weg. Vor der Tür hat man aber einen Bus oder eine Straßenbahnhaltestelle und die Radinfrastruktur ist so sicher, dass man die Kinder alleine zur Schule und zum Sport mit dem Rad fahren lässt. Das heißt aber nicht, dass man sein Auto nicht nutzen darf. Aber Autos sollten halt nicht automatisch für jeden Weg genutzt werden, nur weil sie vor der Türe stehen, weil keine Alternativen vorhanden sind oder weil man glaubt, andere Mobilitätsformen seien unsicher. Das ist wirklich wichtig. Als Mutter sehe ich hier den großen Unterschied. Mein älterer Sohn nahm in Rotterdam sein Rad, um in die Schule, zu Freunden oder zum Sport zu fahren. Hier in Graz ist eine Mutter eher in der Position der Taxifahrerin, die ihre Kinder überall hinfahren muss, weil es nicht so sicher ist, sie alleine auf den Weg zu schicken und der öffentliche Verkehr (vor allem in Stadtrandgebieten) nicht flächendeckend vorhanden ist.
Ein weiteres Thema ist der Pendlerverkehr in die Städte, da sich immer mehr Menschen am Stadtrand ansiedeln. Gibt es in der Stadtplanung Ansätze, diese Verkehrsströme zu reduzieren?
Degros: Eine sehr gute Studie der Uni Wien hat dargelegt, dass die nächste große Herausforderung für uns Stadtplaner*innen die Vorstädte sind. So eine Vorstadt verursacht sehr viel Automobilität. Um das Problem der Mobilität von den Stadträndern in das Stadtzentrum hinein zu lösen, werden wir sehr viel in den öffentlichen Nahverkehr in diesem Bereich investieren müssen. Aber was heißt das für die Leute, die sich für ein Leben in der Stadt entschieden haben? Sind sie damit einverstanden, dass viel von ihrem Steuergeld für den Stadtrand ausgegeben wird, der in vielen Städten ohnehin jener Bereich ist, wo die Leute viel Geld haben? Die Studie hat sehr gut dargelegt, dass wir die Randbezirke dann völlig anders betrachten müssen – als einen Ort, der auch die Leute aus dem Zentrum für einen Besuch anzieht. Wenn man schon eine Transportmöglichkeit für die Gemeinschaft am Stadtrand errichtet, wäre es doch gut, wenn es auch einen Fluss in die andere Richtung gäbe.
Das wirft die Frage auf: Wird die Vorstadt in Zukunft zu einem Ort für die Freizeit? Es wäre vielleicht gut, einen Platz für Kinder außerhalb des Zentrums zu haben, auf dem sie Fußballspielen oder in der Natur Spazierengehen können. Das bedeutet aber, dass der öffentliche Verkehr nicht ausschließlich für die Leute entwickelt werden sollte, die in die Stadt hineinfahren - er muss auch für Leute verfügbar sein, die in der Stadt leben und an Aktivitäten in der Peripherie teilnehmen möchten. Aber es gibt auch noch andere Formen der Mobilität, etwa E-Bikes, mit denen man einen Umkreis von 15 Kilometern gut abdecken kann. Für eine Stadt wie Graz ist das gar nicht schlecht und könnte die Verkehrssituation schon verbessern. Darum investiert das Land Steiermark jetzt auch recht viel in die Radoffensive – nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Außenbezirken.
Der Fokus der Planung soll nicht am Auto liegen, sondern sie soll bei den Fußgänger*innen beginnen, dann auf die Fahrräder blicken, danach auf den öffentlichen Verkehr und erst dann auf das Auto
Gibt es im Bereich Städtebau irgendwelche Trends, speziell wenn es um Verkehr und Mobilität geht?
Degros: Als Institut für Städtebau haben wir bei einem großen Wettbewerb in Luxemburg mitgemacht, zu dem zehn Konsortien aus der ganzen Welt eingeladen waren. Das Ergebnis war ein Manifest, in dem festgehalten worden ist, was wir an unserer jetzigen Art der Planung ändern sollten, um eine nachhaltige Transition unserer Lebensräume zu erreichen. Ein Aspekt war der Bereich der Mobilität. Dort ging es darum, die bestehende Hierarchie in der Mobilität umzudrehen. Der Fokus der Planung soll nicht am Auto liegen, sondern sie soll bei den Fußgänger*innen beginnen, dann auf die Fahrräder blicken, danach auf den öffentlichen Verkehr und erst dann auf das Auto. Das Auto wird also nicht ausgeschlossen, aber man muss beim Planen einfach etwas anders denken. So wäre eine erste Priorität in der Planung eine sichere Umgebung, um zu Fuß in die Schule zu gehen. Wichtig wäre auch ein gutes Netzwerk an Radwegen, lokal und regional.
Ein weiterer wichtiger Punkt war der Mix an Funktionen, den wir bei unseren Planungen zu berücksichtigen versuchen. Dahinter liegt die Idee der 15-Minuten-Stadt von Carlos Moreno von der Sorbonne. Das Konzept sieht vor, dass man in seiner Umgebung zu Fuß in 15 Minuten alle öffentlichen Einrichtungen erreicht, die man regelmäßig benötigt, wie einen Kindergarten, eine Schule, eine Einkaufsmöglichkeit, einen kleinen Park usw. Dieses Konzept reduziert den Bedarf an grundlegender Mobilität.
Dieses Interview ist Teil des TU Graz Dossiers „Städte im Klimawandel“. Weitere Dossiers finden Sie unter www.tugraz.at/go/dossiers.
Sie haben die Hierarchien der Mobilitätsformen angesprochen. Geht es dabei auch darum, welche Form wie viel Platz bekommt?
Degros: Ja, derzeit ist das genau das Thema, bei dem der Schuh drückt. Theoretisch sind hier alle einer Meinung, dass die Fußgänger*innen geschützt werden müssen und das auch besser für die Umwelt wäre. Außerdem wäre das sicher die billigste Form der Mobilität. Aber dann ist da der Straßenraum, der nur eine gewisse Menge Platz bietet, und diesen muss man aufteilen.
In Zürich wurden einige Straßen umgestaltet. Die Planer*innen haben den Raum von der Hausfassade ausgehend betrachtet und zugeteilt, wie viel Platz für die Fußgänger*innen, für die Fahrräder und für die Bäume notwendig ist - und der Rest blieb für die Autos. Sie haben ein Mobilitätskonzept entwickelt, das funktioniert und die passende Größe für aktive Mobilitätsformen hat. Das ist eben eine Frage des Mindsets und es braucht Mut in der Politik, um das zu unterstützen.
Natürlich müssen wir uns der Sorgen und Ängste von Anrainer*innen annehmen. Wenn ein Konzept vorsieht, dass in einem gewissen Bereich alle Autos wegkommen, dann müssen Alternativen angeboten und diese auch kommuniziert werden - beispielsweise eine wenig genutzte Garage in der Nähe. Zusätzlich braucht es effiziente öffentliche Verkehrsmittel.
Sie haben die 15-Minuten-Stadt erwähnt. Welche Vorteile bietet so eine Stadt?
Degros: Theoretisch vereint dieses Prinzip Mobilität, Stadtplanung und den Faktor Zeit. Für mich ist diese Verknüpfung der kluge Kern dieses Konzepts von Carlos Moreno. Man hat innerhalb von 15 Minuten zu Fuß alles zur Verfügung, um sein tägliches Leben angenehm bestreiten zu können. Man fördert dadurch nicht nur eine nachhaltige Mobilität, sondern auch eine lebendige Nachbarschaft. Kritiker*innen des Konzepts der 15-Minuten-Stadt fragten sich allerdings, ob es nicht das Risiko gibt, dass Städte dadurch zu sehr wie mehrere kleine Dörfer funktionieren und die einzelnen Bereiche sich nicht mehr nach außen und zueinander öffnen. Ich sehe Stadt aber nicht als etwas Zentralisiertes, das in Zonen aufgeteilt ist, sondern als Ansammlung kleinerer Zentren. Daher hat das für mich auch nichts Dorfartiges. Es geht eher darum, dass man dezentralisiert und Subzentren hat, was für Graz ein sehr gutes Konzept wäre. Da gäbe es dann etwa St. Leonhard oder Andritz als kleines Subzentrum, und das kann durchaus funktionieren. In St. Leonhard gab es einen Bauernmarkt nahe dem Kindergarten, wo man sehen konnte, dass sich junge und alte Leute trafen. Das war recht schön. Außerdem muss nicht absolut alles innerhalb der 15 Minuten erreichbar sein. Natürlich sollte man manchmal auch weiter nach draußen fahren, um Angebote in anderen Stadtteilen in Anspruch zu nehmen - die Subzentren müssen durch längere Fuß- und Radwege verbunden sein.
Ich empfehle, sich Beacon Hill in Boston anzusehen, denn das kommt meinem Ideal für eine Stadt schon sehr nahe
Wenn Sie eine Stadt aus dem Nichts entwerfen könnten, ohne auf etwas Rücksicht nehmen zu müssen, wie würde die aussehen?
Degros: Ich würde niemals etwas aus dem Nichts planen. Ich finde es viel schöner, eine Stadt mit vorhandenen Gebäuden und Infrastruktur zu transformieren. Es gab mit unseren Studierenden eine Exkursion in die neue Verwaltungshauptstadt von Ägypten. Dort sollen sechs Millionen Menschen leben, die Stadt wurde aus dem Nichts heraus geplant und gebaut. Dort fehlt die Seele, die Geschichte, aber auch Beständigkeit. Das ganze Konzept ist auf Automobilität ausgelegt - man muss viele Kilometer zurücklegen, um von einem Punkt zu einem anderen zu kommen. Alles ist mit achtspurigen Straßen verbunden. Es sieht wie ein Albtraum aus. Wenn man eine kompakte Stadt hat, ist es natürlich viel einfacher, aktive Mobilität zu etablieren als in einer weit ausgedehnten Stadt.
Ich würde genau das Gegenteil machen. Ich würde Gebäude wiederverwenden - es ist gut, mit etwas loslegen zu können, das bereits existiert. Ich würde alles sehr kompakt gestalten. Und dann würde ich sehr genau auf den Abstand zwischen Gebäudeblöcken und Bezirken achten. Aber eine hohe Dichte bedeutet nicht unbedingt, dass es Türme geben muss – das ist ein Irrglaube. Ich empfehle, sich Beacon Hill in Boston anzusehen, denn das kommt meinem Ideal für eine Stadt schon sehr nahe. In Boston ist bis auf einen Hügel alles flach. Früher gab es mehrere Hügel, aber sie haben alles abgetragen und die Erde für den Hafen verwendet. Nur der eine blieb und auf dem befinden sich Gebäude mit einer völlig anderen Typologie als im Rest der Stadt. Es sind klassische Blöcke mit einer recht hohen Dichte, die aber nie höher als fünf oder sechs Stockwerke sind. Dort ist alles kompakt, aber mit schönen Straßen voller Grünpflanzen. Für mich ist das ein sehr schönes Beispiel für gelungene Urbanisierung.
Ein anderes Beispiel, das mir für ein Stadtkonzept wirklich gefällt, ist La Ferme du Rail in Paris. Das ist ein sehr nachhaltiges Projekt und könnte als Pilotprojekt für eine Stadt dienen, die auf grünen Korridoren basiert. Dafür wurde nicht nur die frühere Bahninfrastruktur in einen grünen Ring verwandelt, was fantastisch für Spaziergänge und Radfahrten ist, sondern auch ein Gebäude geschaffen, das eine Kombination aus leistbarem Wohnhaus und Glashaus für Nutzpflanzen ist. Darum heißt es auch die Eisenbahnfarm (Ferme du Rail), weil sie dort anpflanzen, was man dann an Ort und Stelle auf der Promenade kaufen kann. Es wurde auch ein Restaurant und ein kleines Einzelhandelsgeschäft in dem Projekt untergebracht. Das ist ein schöner Wohnort, denn es ist alles aus Holz, bestehende Gebäudeinfrastruktur wird neu genutzt und das Viertel ist gut mit der Vegetation verknüpft. Das passt zu dem, was ich für die Neuentwicklung von Städten empfehlen würde: kompakt bleiben, damit das Wichtigste in kurzer Distanz erreichbar ist, Grünflächen integrieren und das wiederverwenden, was bereits da ist, um eine Stadt zu schaffen, in der jeder in Einklang mit unserem Planeten gut leben kann.
Kontakt
Aglaée DEGROS
Univ.-Prof. Arch.
TU Graz | Institut für Städtebau
Tel.: +43 316 873 6283
a.degros@tugraz.at
TU Graz research monthly
Monatlicher Newsletter rund um aktuelle Forschungsthemen an der TU Graz. Jetzt abonnieren: