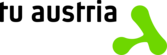I Spy Science: Wie entsteht ein Produkt?
Play video
Jedes Jahr kommen unzählige neue Dinge auf den Markt. Viele davon sind gänzlich neu, andere wieder sind neue Versionen von bestehenden Produkten. Aber wer hat eigentlich die Ideen? Wer plant sie? Wer baut sie?
Mein Name ist Hannes Hick, ich leite das Institut für Maschinenelemente und Entwicklungsmethodik an der TU Graz. Wir beschäftigen uns aus wissenschaftlicher Sicht damit, wie Produkte entstehen, welche Prozesse dahingehend erforderlich sind, aber auch mit welchen Elementen mechatronische Systeme realisiert werden können. Wir untersuchen dabei eingehend alle Komponenten und Teilsysteme die neu entwickelt werden und testen sie, bis hin zum Gesamtsystem. Aber das kommt im Produktentwicklungsprozess erst viel weiter hinten.
Zuerst kommt die Idee für ein neues Produkt oder eine Verbesserung. Diese Idee muss auf Basis einer Vielzahl von Anforderungen ausgearbeitet und die Vor-, Nachteile, aber auch mögliche Probleme bedacht werden. Wir müssen wissen, warum wir dieses Produkt bauen oder verbessern wollen, was es den Kund*innen bringt und wo wir es später einsetzen wollen. Aber natürlich muss auch analysiert werden, welche ähnlichen Produkte es bereits gibt und wie wir uns von diesen unterscheiden können. Immerhin soll ein neues Produkt ja einen Mehrwert für alle Beteiligten bringen. So entsteht ein Konzept, wir nennen dies die Systemarchitektur, welche das neue oder verbesserte Produkt möglichst genau mit allen gewünschten Funktionen beschreibt.
Sind wir uns aller dieser Dinge einmal klar, geht es ans Eingemachte. Jetzt müssen wir das Produkt zuerst auf Systemebene und dann im Detail entwerfen. Wir müssen alle notwendigen Berechnungen und Simulationen durchführen und sicherheitstechnische Überlegungen anstellen. Die möglichst vollständige Modellierung in unserem Digital Lifecycle Lab ermöglicht dabei eine vernetzte Entwicklung zwischen allen Beteiligten. Damit kann viel schneller als in der Vergangenheit mit dem Bau von Teilsystemen begonnen werden. Der 3D-Druck hat uns dabei zusätzlich ganz neue Möglichkeiten gegeben. Wir können sehr schnell erste Strukturen drucken und prüftechnisch untersuchen.
Haben sich die neuen Systemlösungen bewehrt, dann bauen wir erste Prototypen. Sie werden dann umfangreichen Tests unterzogen. Zum Beispiel bei uns im AVL TU Graz Transmission Center, wo wir unterschiedliche Prüfstände betreiben und eine Vielzahl von Tests durchführen. Unter anderem können wir elektrische Antriebsachsen untersuchen, spezifische tribologische Analysen durchführen und Funktionstests machen. Was besonders ist: Wir untersuchen hier schwerpunktmäßig Antriebssysteme, die nicht mit fossilen Brennstoffen betrieben werden – sondern mit Strom und Wasserstoff.
An jedem Punkt im Entwicklungsprozess kann eine weitere Schleife eingezogen werden. Wenn das Produkt zum Beispiel nicht genau das tut, was wir wollen, oder wenn es zu wenig stabil ist. Dann gehen wir einen oder mehrere Schritte zurück und korrigieren den oder die Fehler.
Den gesamten Produktentwicklungsprozess können auch unsere Studierenden im neuen Digital Lifecycle Lab erleben. Wir haben am Institut ein in dieser Form einzigartiges Zusammenspiel verschiedener Softwarelösungen aufgebaut, welches den Produktentwicklungsprozess interdisziplinär abdeckt. In diesem Zusammenhang untersuchen wir auch den Einsatz von KI und neue Softwarelösungen zur gesamtheitlichen Orchestrierung der Produktentwicklung.