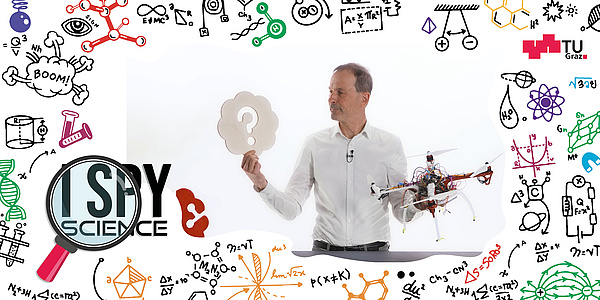I Spy Science: Was ist eine Brennstoffzelle?
Play video
Brennstoffzellen sind optisch äußerst unspektakulär. Innen drinnen schauen sie nicht wesentlich spektakulärer aus. Spannend sind sie aber trotzdem. Nämlich wie sie funktionieren und was sie für unsere Zukunft bedeuten könnten. Mein Name ist Merit Bodner und ich forsche im Institut für Chemische Verfahrenstechnik und Umwelttechnik an Brennstoffzellen. Brennstoffzellen könnten in Zukunft saubere Energieversorgung weitreichend möglich machen. In Fahrzeugen, Minikraftwerken, für zu Hause, in der Schifffahrt oder in Fabriken.
Im Grunde ist so eine Zelle ein elektrochemischer Energiewandler. Sie wandelt also chemische Energie in elektrische Energie um. Sehr häufig werden Brennstoffzellen mit Wasserstoff betrieben, können aber auch andere Brennstoffe wie Methanol oder sogar Ethanol und Ammoniak verarbeiten. Je nach Brennstoffzellentyp geschieht dies bei unterschiedlichen Temperaturen. Der Temperaturbereich für Niedertemperatur-Brennstoffzellen liegt unter 100°C, also unter der Temperatur, bei der Wasser kocht, während Hochtemperatur-Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzellen über dem Kochpunkt von Wasser oder genauer gesagt zwischen 160 und 200°C betrieben werden.
Eine Brennstoffzelle besteht aus zwei Elektroden und einem Elektrolyten dazwischen. Der Elektrolyt leitet die Ionen und ist oft eine Flüssigkeit. Im Fall von Brennstoffzellen werden aber bevorzugt Ionenleitende Feststoffe verwendet, die auch üblicherweise als Membranen bezeichnet werden. So eine Membran ist nur wenige Mikrometer dick und soll aber bis zu zehn Jahre ihren Dienst tun. Sie erfüllt dabei gleich mehrere wichtige Funktionen. Sie trennt den Brennstoff, zumeist Wasserstoff, von der Luft und muss gleichzeitig mechanisch vieles aushalten. Weiters leitet sie die Ionen, während sie gleichzeitig elektrischen Kontakt zwischen den Elektroden verhindern muss. Sie ist also quasi das Herzstück der Brennstoffzelle. Die Elektroden bestehen üblicherweise zum großen Teil aus Kohlenstoff und sind mit einem Katalysator beschichtet, der oft zum Beispiel aus dem seltenen und sehr teuren Platin besteht. Auf der Anode strömt Wasserstoff durch die gasdurchlässigen Schichten und reagiert elektrochemisch an der Katalysatoroberfläche. Bei dieser Reaktion entstehen einerseits Elektronen, die über einen äußeren Kreis als Strom nutzbar sind, und andererseits auch Protonen. Das sind die Ionen, die durch den Elektrolyten, also die Membran, die sich zwischen den Elektroden befindet, transportiert werden. Wenn die Protonen auf die Kathode gelangen, treffen sie dort auf Sauerstoff, der meist in der Form von Luft zugeführt wird. Sie reagieren mit ihm und den Elektronen aus dem äußeren Stromkreis zu Wasser. Neben Strom und Wasser entsteht auch Wärme, die zum Beispiel für Warmwasser genutzt werden kann. Brennstoffzellen müssen einerseits mit Gasen versorgt werden und andererseits müssen sie Strom, Wasser und Wärme abtransportieren. Deshalb braucht es in der Realität viele Komponenten, um Brennstoffzellen zu betreiben. Darin liegt auch eine der Herausforderungen in Sachen Lebensdauer von Brennstoffzellen. Jedes alternde Ventil, jede Dichtung und jedes Kabel ist relevant für den sicheren und verlässlichen Betrieb von Brennstoffzellen. Und auch wenn man einige dieser Komponenten bei Bedarf austauschen kann, ist es bei einigen nicht möglich. Fehlfunktionen können die empfindlichen elektrochemischen Materialien in einigen Fällen beeinträchtigen. Zum Beispiel die Membran, die wie schon erwähnt nur wenige Mikrometer dick ist. Circa 10 bis 20 Mikrometer, um genau zu sein. Das ist weniger als eines deiner Haare. Und diese Membran leistet Schwerstarbeit. Aufgrund der Art, wie sie Protonen transportiert, interagiert sie mit Wasser. Was dazu führen kann, dass sie je nachdem, wie viel Wasser da ist, anschwillt oder zusammenschrumpft. Diese Änderungen verursachen, dass das Material altert und tatsächlich kann man mit freiem Auge beobachten, dass Membranen auch Falten bekommen können, wie wir. Im Fall von Membranen kann diese mechanische Belastung, aber auch chemische Alterung dazu führen, dass sie nicht mehr richtig funktionieren, was heißen kann, dass sie unbrauchbar wird.
Auch die eingesetzten Katalysatoren und kohlenstoffbasierten Materialien werden stark belastet. Insbesondere, wenn sich Betriebsanforderungen wie die Menge an Leistung, die die Brennstoffzelle liefern muss, ändern. Dann strapaziert das die Materialien und lässt sie schneller altern. Daher ist es unerlässlich, die Faktoren, die die Materialien negativ beeinflussen, gut zu verstehen und schädigende Betriebszustände zu vermeiden. Wenn man hier die richtigen Entscheidungen trifft, können Brennstoffzellen heute bereits beeindruckende Lebensdauern erreichen. Die Kombination der Vorteile, dass Wasser, Strom und Wärme die einzigen Produkte sind, die in Betrieb entstehen und so Energie ohne CO2-Emissionen erzeugt werden kann, dass Brennstoffzellen gut skalierbar sind und dass Abwärme ebenfalls genutzt werden kann, machen Brennstoffzellen so interessant für eine Vielzahl an Anwendungen. In Diskussion stehen vor allem der Schwerlastverkehr, die Schifffahrt, aber auch industrielle Anwendungen und Luftfahrt. Insbesondere in industriellen Anwendungen und im Schwerlastverkehr, also in Bussen und LKWs, gibt es bereits heute einige Beispiele, in denen Brennstoffzellen erfolgreich eingesetzt werden.