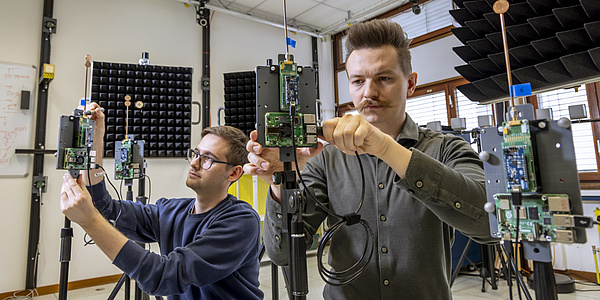Talk Science to Me #53: Wenn Flüsse frei fließen können
Herzlich willkommen bei Talk Science to Me, dem Wissenschaftspodcast der TU Graz. Mein Name ist Birgit Baustädter und heute spreche ich mit Stefan Haun, der das Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der TU Graz leitet und sich in seiner Forschung genau damit beschäftigt.
Lieber Stefan, vielen Dank, dass du heute hier bist und mit mir über Wasserbau sprichst. Stell dich bitte kurz vor und erzähl, wer du bist, was du machst, woran du gerade forschst.
Stefan Haun: Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, heute Gast zu sein und etwas über den Wasserbau erzählen zu können. Mein Name ist Stefan Haun, ich bin seit dem 1. Januar 2025 Leiter des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der TU Graz und freue mich hier meine Ideen einbringen zu können bzw. meine Forschungsbereiche weiterzuführen. Viele fragen oft nach den Forschungsschwerpunkten. Bei uns sind es eher Themenbereiche oder Bereiche, wo wir forschen. Bei mir ist es eben der Wasserbau, hauptsächlich der konstruktive Wasserbau, sprich Bauen im Wasser und am Gewässer. Und auf der anderen Seite der Flussbau, der mich seit Beginn meiner Karriere, seit meinem Doktoratstudium eigentlich triggert.
Du hast Bauwerke im Fluss, am Fluss erwähnt. Was baut man alles um ein Gewässer herum?
Haun: Das, was man sich am leichtesten vorstellen kann, sind eigentlich immer so Querbauwerke, also sprich Wehre oder auch Talsperren, wo man ganze Täler absperrt. Das ist der klassische konstruktive Wasserbau. Natürlich muss man auch dazu sagen, neben den ganzen Absperrbauwerken bauen wir ja auch natürlich Längsverbauten und wir greifen den Fluss selbst ein. Wir sind also im Bereich des Flussbaus tätig. Im Flussbau wollte man den Fluss früher regulieren. Auf der einen Seite wollte man den Menschen schützen, zum Beispiel vor Hochwässern. Und auf der anderen Seite wollte man den Fluss nutzbar machen. Das Einfachste, was man sich darunter vorstellen kann, ist einfach das alte Mühlrad, der Vorgänger von der modernen Wasserkraft, wo man die Kraft des Wassers genutzt hat, um eben dem Menschen einen Nutzen zu bringen.
Du hast gesagt, das hat man früher gemacht. Wie geht man heute mit dem Thema dieser Flussregulierung um? Ist das noch immer etwas, das man tut, also dass man den Fluss selbst in seinem Fließen verändert?
Haun: Heute geht man genau in die andere Richtung. Früher wollte man, wie gesagt, den Fluss regulieren. Das heißt, man hat den Fluss eingesperrt und wir sind ganz oft dazu in ein Korsett gezwängt. Heute brauchen wir den Fluss aus diesem Korsett wieder rauszuholen. Das heißt, wir renaturieren unsere Flüsse, um eben auch wieder einen ökologisch guten Zustand zu bringen. Das heißt, wir haben teilweise Abschnitte, wo wir Uferverbauten rausnehmen, beziehungsweise wo wir auch so mit naturnahen Flussbauten irgendwelche Strukturen in den Fluss hineinbekommen. Wesentlich für mich, und das ist auch eines meiner großen Forschungsfelder, ist eben die Morphodynamik, beziehungsweise das Sedimenttransport im Fluss, wo wir eigentlich einen großen Ansatzpunkt haben, um den Fluss wieder in einen guten Zustand zu bringen.
Aber ist das nicht auch etwas, was irgendwie ein bisschen gefährlich ist, wenn man den Fluss einfach machen lässt? Ich meine, man weiß ja da auch nicht genau, was der dann tut, oder?
Haun: Nein, man schützt eigentlich die Bevölkerung, weil man Hochwasserrückhalteräume, also Retentionsflächen schafft. Stellen wir uns einfach nur vor, wie früher diese Flussauen funktioniert haben, also Gebiete, die teilweise vom Nieder- und vom Hochwasser sozusagen beeinflusst waren. Wenn man den Fluss machen lässt, schafft man eben genau solche Rückhalteräume wieder. Das heißt, man kann eigentlich den Mensch vor Hochwässern schützen. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, wir haben schon Methoden, auch wenn sie meistens empirisch sind, wo man ein bisschen vorhersagen kann, wie sich der Fluss entwickelt, wie viel Raum er braucht. Wenn man aber so eine Renaturierung durchführt, was man immer braucht, ist nämlich ein ausgefeiltes Monitoring, um zu sehen, was der Fluss macht, um eben auch dann, ich sage mal, landwirtschaftliche Flächen oder eben Besiedelungen zu schützen, wenn es wirklich mal in eine andere Richtung gehen würde. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, haben wir Methoden, um das abschätzen zu können, was der Fluss macht, wenn man ihn machen lässt.
Wir haben ja jetzt schon sehr viele Hochwasserschutzanlagen und Hochwasserschutzmaßnahmen. Ist das was aktuelles oder wo geht es da hin?
Haun: Wir haben schon sehr viele Anlagen, wobei man sagen muss, aufgrund des Klimawandels, wie wir gerade erfahren, sehen wir schon noch, dass wir noch einiges an Arbeit vor uns haben. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, früher ganz klassisch die Bauingenieure, damals hat es ja noch keine Damen in unserem Fachbereich gegeben, war es einfach so, dass man gesagt hat, man schützt den Mensch eben durch den klassischen Hochwasserschutz. Man hat dann einfach nach bestem Wissen und Gewissen einfach die Menschen sozusagen vor dem Wasser geschützt, ob das klassisch durch irgendwelche Mauern war oder durch betonierte Rückhaltebecken. Das war einfach ein wesentlicher Teil. Da sind wir heute ein bisschen weiter, wo ich auch ganz froh darüber bin. Wir sind heute beim integrierten Hochwasserschutz. Das heißt, früher waren ja eigentlich, wenn man sich das zeitlich anschaut, früher am Anfang hat man noch mit dem Hochwasser gelebt. Man hat auch noch gedacht, es ist eine göttliche Fügung. Später hat man dann probiert, sich zu schützen, eben mit den Mauern. Und heute probiert man eigentlich, das Hochwasser zu managen. Da spielen aber sehr viele Fachbereiche mit. Und das Schöne ist eigentlich, dass man sozusagen hier auch wieder interdisziplinär arbeitet, um sozusagen den Schutz aufrechtzuerhalten.
Für den Hochwasserschutz schauen wir uns eigentlich an, was kann man vorher schon machen, was passiert während dem Ereignis und was ist eigentlich die Nachsorge. Das heißt, vorher bearbeiten wir sozusagen im Bauingenieurwesen die klassischen Überflutungskarten. Wir schauen uns die Hydrologie an, wir schauen einfach an, was passiert. Unsere Kolleginnen von anderen Fachbereichen, die schauen sich eben das Risiko an, was besteht, sprich was sind die materiellen Güter und so erarbeiten wir eigentlich sozusagen auch Wasserrisikokarten. Basierend darauf passiert dann das Event, wo wir eigentlich Evakuierungen und ähnliches planen und nach dem ganzen Ereignis kommt dann der Aufbau, wo man sich dann diese Lessons learned zur Hand nimmt und sich das Ganze anschaut. Das ist so ein bisschen dieser integrierte Hochwasserschutz, wo wir heute drinnen sind und was ich eigentlich sehr viel nachhaltiger finde.
Mit dem Klimawandel haben wir ein bisschen das Problem, dass die Hochwasserereignisse häufiger auftreten, stärker auftreten und kürzer sein werden. Wir haben diese Starkregenereignisse zum Beispiel, die immer wieder auftauchen. Und ich sage mal rein klassisch mit den Strukturen, die wir bauen, werden wir uns vor solchen Ereignissen nicht schützen können.
Du hast vorher den Sedimenttransport erwähnt. Was genau passiert da?
Haun: Der Sedimenttransport ist eigentlich der Transport von Feststoffen in unseren Fließgewässern. Das ist etwas, was wir eigentlich sehen, wenn wir reinschauen, wenn man die Trübe sieht, sieht man schon den Schwebstofftransport. Was man sehr schwer sieht, ist eigentlich der Geschiebetransport. Das heißt, das ist das Bewegen oder die Sedimente, die sich an der Sohle bewegen, eben gleitend, springend oder hüpfend. So hat das damals Hans Albert Einstein, der Sohn des bekannten Albert Einstein, definiert. Wie gesagt, das ist der Geschiebetransport, den man sehr schwer sozusagen modellieren kann, weil es nur empirische Ansätze gibt. Und auch die Messung vom Geschiebetransport hat so einige Schwierigkeiten.
Warum ist das so schwer?
Haun: Wie gesagt, alles findet relativ nah an der Sohle statt. Das heißt, wenn man mit klassischen Geschiebefängern in ein Fließgewässer reingehen würde, würde man einerseits natürlich die ganze Umgebung stören. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es ist oft so, dass nicht über die gesamte Breite des Fließgewässers gleich viel Transport stattfindet. Dazu schreiben wir gerade an einem Leitfaden, den wir auch veröffentlichen, um der Praxis draußen ein bisschen Hilfe an die Hand zu geben, damit sie Geschiebetransport messen können. Was es auch gibt, und das wird der Leitfaden auch beinhalten, sind neue Messmethoden. Also wie gesagt, früher hatten wir einen klassischen Geschiebefänger, den wir einfach ins Fließgewässer gesetzt haben und dann an einem Ort über gewisse Zeitdauer gemessen haben. Mittlerweile haben wir hydroakustische und andere Methoden, um das besser und hoch aufgelöst zu messen. Hierzu forschen wir zum Beispiel bei unserem Institut eben auch über Geschiebeimpact-Sensoren, wo wir eigentlich sozusagen den Geschiebetrieb hoch aufgelöst messen wollen. Momentan in Gebirgsbächen mit großen Sedimentkörnern.
Du hast gesagt im Labor, wie muss ich mir das vorstellen?
Haun: Im Labor haben wir verschiedene Fließrinnen, das sind sozusagen Glasgerinne, wo wir Versuche durchführen. Das heißt, wir können eigentlich die Randbedingungen sehr klar einstellen, den Durchfluss sozusagen, Fließgeschwindigkeiten oder eben auch die Froude-Zahl, die wir einstellen. Und da machen wir Versuche, indem wir einzelne Körnungen zugeben, also Sedimente, und unsere Impact-Sensoren und den Rückmeldungen geben, was passiert jetzt genau im Fließgewässer. Auf der anderen Seite haben wir auch großflächige Modelle bei uns im Labor, wo wir uns das natürlich auch großkahliger anschauen. Das heißt, wir schauen uns nicht nur das Einzelkorn an, das sich sozusagen im alpinen Gewässer bewegt. Wir können uns auch zum Beispiel Stauräume anschauen. Also was passiert bei Wasserkraftwerken, wenn der Sedimenttransport durch das Wasserkraftwerk behindert wird.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also es gibt jetzt einerseits den freifließenden Fluss und dann gibt es, wie du es vorher schon erwähnt hast, so Querbauten, die das Wasser aufstauen. Wird da dann einfach das Sediment, das da runterkommt und das ganze Geschiebe, wird da dann einfach in dem Becken gespeichert?
Haun: Wir haben einen Stauraum und da wird eben auch das Sediment aufgestaut. Das heißt, die Transportfähigkeit des Flusses lässt nach, das Sediment setzt sich ab und landet sozusagen unseren Stauraum an. Das kann zu Problemen führen, weil wir natürlich einerseits eine höhere Sohle haben, das heißt, wir können Hochwasserprobleme bekommen, aber natürlich auch für den Betreiber in dem Moment, wo Stauraum verloren geht, geht natürlich auch beim Wasserkraftbetreiber das Potenzial zurück, Energie zu erzeugen. Auf der anderen Seite, das macht es so spannend, fehlt natürlich im unterstromigen Bereich der Wehranlage das Sediment. Das heißt, der Fluss hat eine sehr hohe Transportkapazität, aber das Sediment-Dargebot ist relativ klein. Das heißt, der Fluss holt sich das Sediment aus der Sohle, was zur Folge hat, dass einerseits Uferanbrüche passieren können und auf der anderen Seite auch der Grundwasserspiegel abfällt. Das heißt, haben wir zum Beispiel landwirtschaftliche Flächen in der Nähe vom Fluss, wäre der Grundwasserspiegel in dem Moment tiefer oder würde absinken und die Pflanzen würden weniger Wasser aus dem Grundwasser bekommen. Das sind so ein bisschen diese Schwierigkeiten, das macht das System eigentlich so spannend, weil wie in meisten Systemen, wenn man irgendwo eingreift, das nicht dem einen Effekt hat, sondern man hat verschiedene Effekte auf verschiedenen Skalen und das ist auch so beim Wehr.
Wie kann man da jetzt damit umgehen als Betreiber*in?
Haun: Wie man damit umgeht, ist eigentlich relativ klar. Man müsste eigentlich aktives Sedimentmanagement im Stauraum betreiben. Das große Problem, was man hat, ist, dass jeder Stauraum sehr individuell ist, beziehungsweise jedes Kraftwerk sehr individuell. Wir arbeiten gerade an einem Konzept für einen Stauraum in Bayern, wo wir genau das uns anschauen wollen. So eine Sedimentmanagement-Strategie soll nämlich auf der einen Seite wirtschaftlich sein, sie soll effizient sein und das Wichtigste ist auch, dass es sehr ökologisch ist. Da überlegen wir uns gerade, wie könnte das Sedimentmanagement dort aussehen.
Welche Ansätze gibt es da?
Haun: Es gibt verschiedenste Ansätze. Ganz klassisch, man kann anfangen mit dem Baggern. Das heißt, man baggert sozusagen einfach den Stauraum aus. Das war auch die kostenintensivste Variante. Vor allem, wenn wir irgendwelche Stoffe im Stauraum haben, die eigentlich nicht reingehören, wie zum Beispiel Schadstoffe. Dann muss man das Sediment, das man rausbaggert, deponieren. Und das wird dann sehr kostspielig. Es gibt natürlich noch andere Varianten, wie zum Beispiel Zwischendinge wie Saugbagger oder eben auch diese klassische Stauraumspülung. Das heißt, man öffnet im Hochwasserfall die Wehre und lässt sozusagen das Sediment nach unten durch. Man muss aufpassen, das ist auch ökologisch sehr gefährlich, weil wenn man das Ganze nicht richtig plant und nicht richtig durchführt, kann das wirklich ein ökologisches Desaster im Unterstrombereich resultieren.
Aber es gibt Möglichkeiten, das umweltverträglich zu machen?
Haun: Meiner Ansicht nach gibt es diese Möglichkeiten. Das ist eine sehr gewissenhafte Planung, die im Vorfeld passieren muss. Und das Zweite muss auch das Monitoring während dieser Stauraumspülung sein. Wir haben meistens zwei Faktoren, die wir uns anschauen während der Spülung. Das ist einerseits die Schwebstoffkonzentration und die Strömung, die zum Beispiel die Fische mit sich nimmt, die aber auch zum Beispiel Abrasion der Kiemen hervorruft. Und auf der anderen Seite haben wir auch den Sauerstoffgehalt, der nicht immer relativ hoch sein muss, beziehungsweise in einem gewissen Rahmen, damit eben die Fische überleben. Aber natürlich, man sollte sich auch die Ökologie ein bisschen breiter anschauen. Oft wird der Fisch genannt, aber auch Wirbellose im Unterstrombereich und auf die sollte man ja auch schauen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat man das sehr gut im Griff.
Das heißt, du bist eigentlich Bauingenieur, aber es sind sehr viele Themengebiete, die dann trotzdem in dein Forschungsfeld reinspielen, oder? Also wenn man sich jetzt die ganze Ökologie anschaut, natürlich auch die Biologie, weil du verstehen musst, was die Fischer brauchen und so.
Haun: Ich sage mal so, klassisch gesehen war der Bauingenieur oder die Bauingenieurin jemand, der früher einfach was gebaut hat. Das heißt, man war eine Disziplin, wo man gearbeitet hat. Man hat natürlich sich noch die Bodenmechanik dazu geholt, die Felsmechanik und verschiedene andere Disziplinen. Mittlerweile sind wir aber wirklich multidisziplinär unterwegs. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, die Ökologie ist ein wesentlicher Teil. Das heißt, ich sage mal, ohne Ökologie würde man heutzutage nichts mehr bauen. Wir müssen aber auch überlegen, was macht man mit der Gesellschaft, wenn man was baut, wenn man zum Beispiel hier Hochwasserrückhaltebecken anlegt oder wenn man große Flussregulierungen macht. Es gibt also sehr viele Stakeholder, die mitspielen und die man berücksichtigen muss. Das heißt, ich würde wirklich sagen, das Bauingenieurwesen ist mittlerweile ein sehr multidisziplinäres Fach, wo man sehr viele Fachgebiete abdecken muss.
Was war das, was die so fasziniert haben in diesem Forschungsbereich? Warum bist du in den Wasserbau?
Haun: Ich habe an der TU Graz schon studiert damals, wollte eigentlich im Tunnelbau vertiefen, habe mich dann aber irgendwie in die Richtung Wasserbau bewegt. Der Grund war eigentlich die Vorlesung Fluss- und Sedimenthydraulik. Daher sieht man auch schon, was mich da eigentlich damals schon getriggert hat. Das war eigentlich der Grund, weil ich gesehen habe, wie interdisziplinär dieses Feld ist und zweitens, wie spannend dieses Feld ist. Das war für mich so ein bisschen dieser Moment, wo ich entschieden habe, dass ich diese Laufbahn eigentlich einschlagen will.
Aber war das schon immer so, also Wasser war das schon immer ein Thema, das dich fasziniert hat?
Haun: Wasser war immer Teil meines Lebens, aber es hat mich eigentlich nie so fasziniert, dass ich gesagt hätte, ich will da drinnen alt werden, also ich will da drinnen arbeiten. Das ist eigentlich erst später gekommen und eigentlich erst durch die Ausbildung an der TU Graz.
Thema Wasserkraftwerke: Sie sind, wie wir schon erwähnt haben, ein großer Eingriff auch in den natürlichen Fluss des Flusses, in die Ökologie und in die ganze Umgebung. Wie verträglich sind Wasserkraftwerke eigentlich? Man hat da auf der anderen Seite so das Thema mit dem grünen Strom. Es ist sehr nachhaltig, es ist sehr verträglich. Und auf der anderen Seite hat man aber diesen massiven Eingriff. Wie stehst du da dazu? Also wie verträglich ist Wasserkraft und Wasserkraftwerke?
Haun: Wasserkraft, muss man dazu sagen, ist wirklich auch, ich sage mal, das Rückgrat der Energiewende, wie wir es gerne sagen. Es ist erneuerbare Energie, es ist sehr effizient und Wasserkraftwerke haben eine sehr hohe Lebensdauer. Das sind alles Dinge, die dafür sprechen, dass man den Ausbau der Wasserkraft weiter treibt. Aber natürlich ist ein Wasserkraftwerk, beziehungsweise wenn man den Fluss nutzbar macht für die Erzeugung von elektrischer Energie, ist es auch ein Eingriff in die Natur. Wir haben ja schon von den Sedimenten gehört, das heißt, ein Querbauwerk für das Wehr unterbindet den Sedimenttransport noch weuter. Wir modifizieren aber natürlich auch die Hydrologie, sprich den Abfluss. Das heißt, wenn die Turbine ans Netz geht, wenn wir Strom aktuell brauchen, dann produzieren wir im Unterstrombereich auch einen Schwall. Beziehungsweise wenn die Turbine vom Netz geht, produzieren wir einen Sunk. Das heißt, wir haben einen Anstieg vom Wasserspiegel, der relativ schnell passieren kann, und auch einen Abfall. Das heißt, auch dort spielt die Ökologie mit. Wir haben da das Risiko des Fischstranding. Das heißt, dass die Fische sozusagen nicht mehr in das Hauptbett zurückschwimmen können. Also da sieht man schon, dass es Einflüsse gibt. Wenn wir schon bei den Fischen sind, auch die Fischwanderung wird unterbunden von unseren Wasserkraftanlagen. Manche Arten der Fische schwimmen nach Oberstrom beziehungsweise bewegen sich. Das heißt, in dem Moment, wo wir das Querbauwerk bauen, unterbinden wir diese Fischwanderung und was wir deshalb bauen, sind sogenannte Fischaufstiege, das können Fischleitern sein, das können Fischlifte sein, wo man dem Fisch das wieder ermöglicht, dass er nach oben migriert.
Was bisher relativ wenig untersucht ist, ist eigentlich der Fischabstieg, das heißt, wenn der Fisch wieder nach Unterstrom wandert und dann unter anderem auch durch die Turbine gerät. Da haben wir eine einzigartige Forschungsinfrastruktur mittlerweile an der TU Graz, und zwar eine Fisch-Paratraumakammer, wo man sozusagen diesen Fischabwanderung durch die Turbine untersucht. Wenn der Fisch abwandert, gibt es einen Druckabfall, der relativ hoch ist. Und da schauen wir uns an, welche Schäden der Fisch davon trägt. Aber hier muss ich auch sagen, dass es momentan sehr viel Forschungsbedarf gibt, aber auch sehr viel Forschung gefördert wird. Und ich finde das ist sehr wichtig, weil wenn man Wasserkraftanlagen plant, beziehungsweise mittlerweile umbaut oder revitalisiert, dann finde ich es sehr wichtig, dass man die Ökologie und die Wasserkraftnutzung da ein bisschen hinein nimmt.
Wie suche ich mir eigentlich den Standort für ein Kraftwerk aus? Also kann ich das tatsächlich überall bauen oder wird da genau drauf geschaut, wie so die Umgebung ist, wie da der Fischbestand ist und so?
Haun: Wo man das Wasserkraftwerk baut, das lernt man bei uns in der Vorlesung. Wenn die Studierenden bei uns im Bachelor beginnen, bekommen sie mit konstruktivem Wasserbau erste Einblicke und im Master vertiefen wir das Ganze dann in Form von Projekten, wo sie dann wirklich Anlagen konzipieren müssen. Natürlich hängt das immer sehr stark davon ab, welches Wasserkraftwerk man baut, ob das jetzt ein Pumpspeicherkraftwerk ist, ob das ein Flusskraftwerk ist. Das heißt, man sucht sich den Standort immer sehr genau aus mit sehr vielen unterschiedlichen Einflussfaktoren. Da sieht man auch wieder dieses multidisziplinäre Arbeiten. Das heißt, sie schauen sich da die Hydrologie an, sie schauen sich sozusagen den Standort an mit der Geologie, mit der Bodenmechanik, mit der Felsmechanik. Das heißt, es spielen da sehr viele Dinge mit. Und so guiden wir eigentlich unsere Studierenden durch das Fachgebiet bzw. im Laufe ihrer Ausbildung eben dahin, dass wenn sie dann fertig sind, dass sie dann draußen in der Praxis wirklich schon direkt in Projekte einsteigen können. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch ein bisschen unser Anspruch, dass man sie darüber hinaus ausbilden, dass wenn jemand in der Forschung bleiben will, dass sie auch dort schon sehr viele Themenbereiche kennenlernen, wo man eben zukünftig Forschung betreiben kann.
Welche wären das zum Beispiel? Also wo ist da noch Forschungsbedarf?
Haun: Forschungsbedarf in unserem Feld, das gibt es noch sehr viel. In unserem Fachbereich das Spannende ist eigentlich, dass wir einerseits mit numerischen Modellen arbeiten. Das heißt, wir simulieren am Computer von 1D bis dreidimensional, verwenden wir sozusagen alle Modelle. Aber andererseits haben wir eben auch unsere Laborhalle mit einer Infrastruktur, zum Beispiel für Hochdruckanlagen. Das heißt, wir haben ein Tieflabor, wo wir die Wasserkraftbetreiber*innen unterstützen können, eben zum Beispiel beim Ausbau von Pumpspeicherkraftwerken. Das heißt, wir können Triebwasserstollen nachbauen, wir können Wasserschlösser nachbauen, wir können Drosseln in Wasserschlössern nachbauen, um eben zu simulieren, was ist die Auswirkung bzw. was ist der Wirkungsgrad von diesen Bauwerken. Wir haben sehr viel über Sedimente gehört. In dem Sedimenttransport gibt es relativ wenig Formeln. Das meiste ist sehr empirisch hergeleitet. Diese empirischen Formeln backen wir in numerische Modelle, um eben Vorhersagen zu treffen. Wichtig sind Daten immer, Messdaten. Wir haben schon von Geschiebetransport gesprochen, den man sehr schwer messen kann. Die Daten brauchen wir nicht nur, um Prozesse zu verstehen bzw. um Analysen zu machen, sondern eben auch, um unsere Modelle zu kalibrieren. Das alles ist so ein bisschen Teil unserer Forschung.
Das heißt, ihr habt in den Laboren und in den Hallen, die ihr zur Verfügung habt, richtige Modelle und könnt dort bauen und nachstellen und nachbilden.
Haun: Richtig, wir bauen sozusagen alles, was wir draußen in der Natur sehen, in klein nach, im Maßstab. Wichtig ist, wir skalieren das natürlich einerseits im Maßstab hinunter, dass diese Phänomene, die Prozesse, die in der Natur ablaufen, auch im Modell richtig ablaufen. Das heißt, wir skalieren unsere Modelle nicht nur im Größenmaßstab, sondern eben auch zum Beispiel aufgrund von der Zähigkeit, der Flüssigkeit oder anderen Dingen. Wir haben zwei Labore, eines in der Innenstadt und eines im Innenfeld draußen. Das im Innenfeld ist ein Freilabor, wo wir sehr große Flächen haben, um eben auch große Modelle zu bauen. Man muss sich aber vorstellen, es gibt Modelle, die in die Fläche gehen, also Flächenmodelle. Wir haben gerade ein großes Wasserkraftwerk in Salzburg nachgebaut mit ein paar hundert Meter Oberstrom und Unterstrom. Und auf der anderen Seite haben wir auch Modelle, die in die Höhe gehen. Wir haben zum Beispiel gerade eine Hochwassereintlastung bei einem großen Staudamm in Österreich, die wir nachgebaut haben, um dort die Förderfähigkeit der Hochwassereintlastung zu untersuchen. Wobei wir aber gleichzeitig auch den Lufteintrag bzw. die Druckverteilung im Druckstollen untersuchen. Das heißt, hier bauen wir in die Höhe, wir bauen in die Breite. Also wir haben sehr viel Versuchsfläche, um verschiedenste Arten von Versuchen durchzuführen.
Gibt es in Österreich eigentlich noch Kapazitäten, neue Wasserkraftanlagen zu bauen?
Haun: Ja, es gibt noch Kapazitäten. Es wird aber, muss ich sagen, immer schwieriger, neue Anlagen zu bauen. Das ist das eine. Das andere, was natürlich auch immer sehr gefragt ist, ist momentan der Ausbau. Vor allem bei den Hochdruckanlagen haben wir früher klassische Speicherseen gehabt im Hochgebirge, die sich über mehrere Jahre gefüllt haben, wo das Wasser sukzessive abturbiniert wurde. Diese Anlagen bauen wir heutzutage in Pumpspeicherkraftwerke um, eben auch um die Energiewende mitzutragen. Diese Pumpspeicherkraftwerke sind eigentlich wie große Batterien, die man sozusagen in unseren Gebirgen bauen bzw. umbauen kann, wo man, wenn Energiebedarf ist, das Wasser abdurbinieren kann, um elektrische Energie zu erzeugen. Und auf der anderen Seite, wenn kein Bedarf an Energie da ist bzw. auch zu viel Energie im Netz, eben zum Beispiel durch Wind oder durch Solarkraftwerke, dann verwenden wir eben diesen Strom, um das Wasser wieder nach oben zu pumpen in die oberliegenden Becken. Das ist sozusagen das Prinzip der Pumpspeicherkraftwerke, wo man eben Energie speichern kann. Und da zahlt sich die Wasserkraft aus aufgrund der großen Effizienz.
Hast du ein Lieblingswasserkraftwerk?
Haun: Ein Lieblingswasserkraftwerk habe ich keines. Ich muss sagen, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich verschiedene Kraftwerke sehe. Ich muss sagen, es sind einerseits die älteren Kraftwerke total faszinierend, weil man sich überlegt, wie hat man vor 100 Jahren so ein Kraftwerk gebaut, wie hat man probiert, diesen Fluss während dem Bau zu bezwingen und was kann man herausholen. Und auf der anderen Seite faszinieren mich natürlich die neuen Kraftwerke immer, weil so viele Dinge zusätzlich betrachtet wurden, wie eben zum Beispiel der Fischaufstieg, die ganze Ökologie, das Sediment- und Stauraummanagement. Ich habe keinen Liebling, unter Anführungszeichen, aber es hat jedes irgendwas Spezielles, was mich immer wieder fasziniert.
Wo beobachtest du, dass es in der Forschung und im Bau auch hingeht? Also was sind die wichtigen Themen in Zukunft? Beziehungsweise wie wird man auch bauen und sich mit dem Fluss beschäftigen?
Haun: Wesentlicher Punkt, glaube ich, bei den zukünftigen Baumaßnahmen, die wir setzen, ist eigentlich die Nachhaltigkeit und die ökologische Betrachtung. Das werden so zwei große Punkte werden, die wir uns anschauen müssen. Dazu gibt es einiges an Forschungsbedarf. Wie wir heute schon kurz angesprochen haben, eben im Flussbau. Der nachhaltige und der naturnahe Flussbau werden immer stärker in den Vordergrund rücken. Unsere Flüsse werden renaturiert werden. Da sehe ich sehr viel Bedarf, dass wir hier mehr Erkenntnisse schaffen bzw. mehr Einblick generieren, um das auch nachhaltiger durchzuführen. Die Ökologie ist hier immer wesentlich, aber das ist ein großer Schritt weg vom klassischen Wasserbau hin zum naturnahen Wasserbau. Auf der anderen Seite auch, wie gesagt, der Ausbau der Wasserkraft wird uns weiterhin beschäftigen. Wir brauchen eben diese Energiewende oder wir sind Teil dieser Energiewende. Da müssen wir schon noch einiges an Arbeit leisten und da können wir auch mithelfen, dann irgendwelche Systeme zu optimieren. Aber da ist auch noch einiges an Forschungsbedarf dabei.
Der letzte Punkt, weil wir ihn gerade heute auch schon angesprochen haben, ist der Hochwasserschutz. Ich sage mal, dieser integrierte Hochwasserschutz, der mehrere Fachbereiche umfasst. Da ist noch einiges notwendig, um da Reibungsverluste zu minimieren, aber auch sich Strategien für die Zukunft zu überlegen. Da müssen wir auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus blicken. Wir sehen das ja sehr oft mit unserer europäischen Brille, wo sehr viel passiert ist. Aber natürlich, wenn man sich das Ganze jetzt weltweit anschaut und auf einer ganz anderen Skala, dann sieht man schon, dass im Bereich des Hochwasserschutzes weltweit noch relativ wenig passiert ist. Von daher sehe ich eigentlich in unserem Fachbereich noch einiges zu tun.
Vielen Dank für das Interview.
Haun: Ich sage danke.
Vielen Dank, dass Sie heute wieder zugehört haben. In der nächsten Folge spreche ich mit Manuel Pirka, dessen Forschungsgebiet der Sedimenttransport in Flüssen ist.