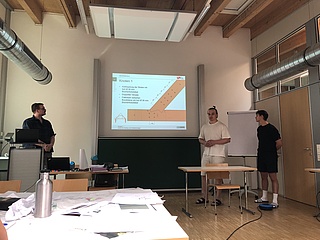LV Konstruktionen in Holz
- geführt nach den Grundgedanken der "Meisterklasse"
In einem offenen Brief von Julius POSENER [1904-1996, Architekt] nimmt dieser 27jährig im Jahre 1931 "Zur Reform des Hochschulstudiums" Stellung und schreibt: "Die Meisterklassen sind nicht das letzte Wort einer möglichen Studienreform. Aber sie sind der erste Schritt der wirklichen." Er erwähnt darin wie wichtig es sei, das Trennende zwischen den Fächern zu überwinden und eine enge Zusammenarbeit zwischen den Lehrstühlen zu fördern. In diesem Zusammenhang erwähnt er, dass dies am besten durch die Stellung von praxisrelevanten "Aufgaben" gelingen würde. Das Trennende verschwindet, das Verbindende folgt über die Projektbearbeitung. Was sind nun die wesentlichen Charakteristika einer Meisterklasse? Kurz: Ausgewählte Studierende arbeiten für eine bestimmte Zeit an einer gestellten Aufgabe und werden dabei von einem kompetenten Betreuer-Team unterstützt.
Christopher ALEXANDER [geb. 1936, Architektur-, Systemtheoretiker und Philosoph] spricht in seinem Buch "Eine Muster-Sprache" ein Netzwerk des Lernens an und fordert den Zugang zu ALLEN Lernquellen und meint weiter, dass der beste Lernerfolg dann erzielt werden würde, wenn der Lernprozess nach den traditionellen Methoden von "Meister und Lehrlingen" aufgebaut wird, sprich: "wenn man jemandem, der sich wirklich auskennt, zur Hand geht." Auch der Physiker und Nobelpreisträger Richard P. FEYNMAN [1918-1988] meint: "..., dass die einzige Lösung für das Bildungsproblem die Erkenntnis ist, dass der beste Lehrerfolg erzielt wird, wenn eine direkte, persönliche Beziehung zwischen dem Studenten und einem guten Lehrer besteht - ein Zustand, bei dem der Student die Ideen diskutiert, über die Dinge nachdenkt und darüber spricht..."
Daraus lässt sich durchaus der Schluss zu ziehen, dass das "Meister-Schüler-Prinzip" verbunden mit der "Vernetzung von Knotenpunkten" - sprich: die Zusammenarbeit zwischen Lehrstühlen, das Zulassen unterschiedlicher Lehrmeinungen und das Einbinden interner und externer Kompetenzen - ein anzustrebender Zustand wäre, um den oben angesprochenen besten Lernerfolg auf universitärer Ebene erzielen zu können. [Graz, 30. Juni 2017, GS]
Betreuer-Team 2017: R. Brandner, A. Ringhofer, G. Schickhofer, R. Sieder, H. Stingl, J. Zehetgruber, S. Zimmer
Gäste: Arch. J. Frey, Arch. R. Frey-Müller, Arch. M. Strobl jun.
|
|
|
Der letzte Eintrag ist mit 30. Juni 2017 datiert und die beiden Bilder zeigen die LV-Teilnehmer und das -Betreuerteam aus dem Jahre 2017. Die LV KiH wurde danach natürlich alljährlich abgehalten, zeigt aber, wie schnell doch die Zeit verfliegt. 2025 waren es zwar nicht mehr so viele Teilnehmer wie 2017 (es gab drei Teams mit je drei Studierenden), die Qualität der Arbeiten war aber, wie schon in den vergangenen Jahren, auf einem sehr hohen Niveau.
Betreuer-Team 2025: G. Schickhofer, D. Glasner, G. Silly, J. Zehetgruber, Arch. M. Strobl jun.
Gast: D. Matzler (von der holz.bau forschungs gmbh)
Teilnehmer: Gruppe 1: S. Leiz, M. Schmid, S. Reisecker | Gruppe 2: P. Preißner, V. Fensterseifer, M. Stöhr | Gruppe 3: T. Mair, P. Groos, D. Ruhmer
Aufgabenstellung 2025:
Für ein Bestandsobjekt - einen so genannten Pfeiler-Stadl - war ein Konzept zu erarbeiten, wobei als Ziel die Umnutzung zu einem "Haus der Handarbeit" vorgegeben war. Es sollte neben dem EG-Bereich eine weitere Ebene (Decke) eingezogen werden, womit eine Verdoppelung der Nutzfläche erreicht werden kann. Drei Varianten hinsichtlich der Holzbauweisen - 1.) "Schnittholz und zimmermannsmäßige Verbindungstechnik", 2.) "Holzbauprodukte und ingenieurmäßige Verbindungstechnik" und 3.) "Flächentragwerke und passende Verbindungstechnik" - standen zur Auswahl und wurden im Rahmen der zwei geblockten LV-Wochen von den drei oben erwähnten Teams erarbeitet.
Präsentationsfolien der Gruppe 1|25 zu Variante 1
|
|
Technische Universität Graz
Inffeldgasse 24
A-8010 Graz Tel.: +43 (0)316 873 - 4601
Fax: +43 (0)316 873 - 4619
lignum@tugraz.at