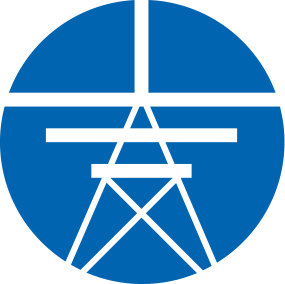Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
Chancen und Herausforderungen der Elektromobilität im Hinblick auf elektrische Anlagen und Netze
Durch die stetig wachsende Zahl von notwendigen Ladestationen und das Streben nach immer höheren Ladeleistungen nehmen ebenso die Herausforderungen an den Schutz gegen elektrischen Schlag zu. Höhere Ladeleistungen bringen höhere Ladespannungen und Stromstärken mit sich – je höher die Stromstärke, umso technologisch herausfordernder sind die anzuwendenden Schutzmaßnahmen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben müssen mehrere Komponenten, wie die Schutzeinrichtungen der Ladestation selbst, der Basisschutz bis hin zum Steckverbinder, die Erdungs- und Potentialausgleichsanlage sowie die Software der Ladestation perfekt auf einander abgestimmt sein und miteinander interagieren. Moderne Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sind Bestandteil komplexer elektrischer Anlagen, deren Komponenten einerseits verschiedenen Anforderungen genügen müssen und andererseits aufeinander perfekt abgestimmt sein, sodass sie gesamtheitlich sicher und zuverlässig funktionieren. Der rasche technologische Fortschritt auf diesem Gebiet erfordert ein umfangreiches Wissen auf vielen Sektoren, beispielsweise beginnend vom Drehstrom-Mittelspannungsnetz bis hin zum Gleichstrom-Ladekreis von Schnellladestationen.
Aufgrund der langen Erfahrungen des IEAN auf diesen Gebieten und der hohen Motivation, neue Technologien voranzutreiben, haben sich Elektrofahrzeug-Ladestationen als eines der Forschungsschwerpunkte am Institut etabliert, einige Beispiele zu diesem Themenfeld sind:
- Analyse von Ladevorgängen und -verfahren an AC- sowie DC-Ladestationen für Elektrofahrzeuge
- Erst- und wiederkehrende Prüfung von DC-Ladestationen für Elektrofahrzeuge
- Schutzerdungs- und Potentialausgleichsanlage für Ladeinfrastruktur
- Normen- und Standardisierungsarbeit im Bereich der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
Wiederkehrende Prüfung von Ladeinfrastruktur
Betreiber von Ladeinfrastruktur übernehmen mit der Errichtung bzw. der darauffolgenden Inbetriebnahme und dem Betrieb gewisse Verantwortungen gegenüber deren Mitarbeiter*innen bzw. gegenüber deren Kund*innen im Hinblick auf die Einhaltung des notwendigen Maßes an entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Diese konzentrieren sich ist vorrangig auf die Sicherstellung des Personenschutzes und der Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag. Dabei gilt es im Wesentlichen sicherzustellen, dass der Schutz dauerhaft gewährleistet wird, wodurch die Gefahr durch elektrischen Strom für den Menschen auf ein vertretbares Minimum reduziert wird. Zur regelmäßigen und reproduzierbaren Überprüfung des Schutzes und der Schutzmaßnahmen bedarf es geeigneter Methoden samt zugehöriger Prüfgeräte. Im Falle von AC-EVCS gelingt dies problemlos unter Einhaltung der nationalen Regelwerke (u.a. Elektrotechnikverordnung ETV 2010, Elektroschutzverordnung ESV 2012, OVE E 8101, OVE Richtlinie R 30) mittels eines herkömmlichen Installationstesters in Verbindung mit entsprechenden Adapterlösungen – beispielsweise auf Typ-2-Steckverbinder. Die wiederkehrende Überprüfung von DC-EVCS stellt allerdings eine entsprechend größere Herausforderung dar und kann nur mittels aufwändigen Elektrofahrzeug-Emulatoren in Verbindung mit geeigneten Prüfgeräten erfolgen. In Zusammenarbeit mit Partnern der Branche und dem IEAN ist es gelungen, einen solchen Elektrofahrzeug-Emulator (Prüfgerätedemonstrator) samt zugehöriger Prüfroutinen zu entwickeln, um DC-Ladestationen im Feld im Sinne einer wiederkehrenden Prüfung zu überprüfen. Darüber hinaus konnten die wesentlichen Erkenntnisse aus den zugehörigen Arbeiten in die Überarbeitung der OVE-Richtlinie R 30 einfließen, welche nun neben AC-EVCS auch die wiederkehrende Prüfung von DC-EVCS behandelt. Die nachfolgende Abbildung zeigt einen beispielhaften Feldtest einer DC-Ladestation (max. 160 kW DC). Weitere Informationen zum Projekt: https://www.ove.at/energiewende/projekt-prosafe2/
Integration von Ladeinfrastruktur in Niederspannungsnetze
Ebenso befasst sich das Institut mit facheinschlägigen Themen rund um gesteuertes Laden von Elektrofahrzeugen, welche primär auf die Dargebotsabhängigkeit von elektrischer Energie aus erneuerbaren Quellen, sowie auf mögliche Grenzen der Infrastruktur (Auslastung des Netzes, etc.) eingehen. Der Forschungsbedarf resultiert aus folgenden Herausforderungen:
Die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist hauptsächlich in der Niederspannungsebene (Netzebene 6 bzw. 7) angesiedelt. Leistungsstarke Ladestationen mit 11/22 kW AC und ≥ 50 kW DC können zu einer entsprechenden Mehrbelastung der zugeordneten Netzebene führen. Von Interesse und somit Bestandteil von mehreren Forschungsprojekten sind unter anderem die Analyse der Integration einer entsprechenden Anzahl an Ladestationen in bestehende Stromversorgungsnetze zB mit Hilfe von Durchdringungsszenarien und Laststeuermöglichkeiten.
Kann die geforderte Ladeleistung durch das bestehende bzw. entsprechend angepasste Netz nicht bereitgestellt werden, so ist ein Netzausbau unabdingbar. Es ist durchaus möglich, dass dabei die zur Versorgung notwendigen Anlagenkomponenten, wie zB Kabel, Transformatoren und Schutzeinrichtungen neu dimensioniert werden müssen. Bei neu zu errichtenden Ladeparks mit einer entsprechenden Anzahl von EVCS mit Ladeleistungen im Bereich von 50/150/350 kW oder mehr ist dies ohnehin Gang und Gebe.
Projekte
Kontakt