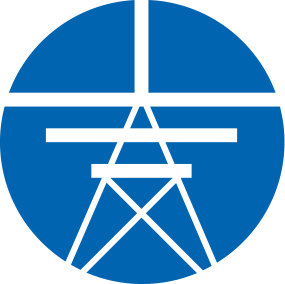Regelung und Stabilität elektrischer Energiesysteme
Allgemeine Informationen
In den letzten Jahren hat sich das Verhalten elektrischer Energiesysteme signifikant verändert. Diese Entwicklung ist vor allem durch den verstärkten Einsatz leistungselektronisch gekoppelter Technologien wie Windkraftanlagen, Photovoltaiksysteme, Batteriespeicher, FACTS und HVDC-Verbindungen geprägt. Aufgrund dieser veränderten Systemdynamik wurde durch IEEE die jahrelang bewährte Klassifizierung der Netzstabilität überarbeitet.
Die bisherigen Einteilung in Rotorwinkelstabilität, Spannungsstabilität und Frequenzstabilität wurde beibehalten und zwei neue Hauptkategorien hinzugefügt die sogenannte „Umrichterstabilität“ sowie die „Resonanzstabilität“. Diese Erweiterung ermöglicht eine ganzheitlichere Abbildung der Stabilitätsprobleme moderner Stromnetze, die zunehmend durch komplexe Reglerdynamiken bestimmt werden.
Abbildung 1: Einteilung der Stabilitätskriterien nach [1]
Zeitskalen dynamischer Phänomene
Die Beschreibung und Analyse von Stabilitätsphänomenen erfolgt auf Basis charakteristischer Zeitskalen. Elektromechanische Vorgänge wie Frequenz- oder Winkelabweichungen bewegen sich im Bereich von Sekunden und lassen sich häufig durch phasorbasierte Modelle ausreichend genau beschreiben. Demgegenüber stehen transiente und elektromagnetische Phänomene, die im Millisekundenbereich und darunter auftreten. Diese schnellen Effekte gewinnen im Kontext leistungselektronischer Einspeiser zunehmend an Bedeutung.
Spannungsstabilität und Frequenzstabilität im Kontext moderner Netze
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen kurz- und langfristiger Spannungsstabilität. Kurzfristige Instabilitäten entstehen oft durch schnell reagierende Lasten wie Induktionsmotoren oder durch HVDC-Konvertern, insbesondere bei schwachen Netzanschlusspunkten. Langfristige Instabilitäten zeigen sich hingegen durch langsam auftretende Spannungsinstabilitäten infolge langsamer Stellprozesse wie Transformator-Stufen-Regelungen oder unzureichender Blindleistungsbereitstellung von Generatoren.
Der Wegfall synchroner Maschinen reduziert nicht nur die Trägheit im System, sondern verändert auch die Mechanismen der Frequenz- und Spannungshaltung grundlegend. Während konventionelle Generatoren über ihre rotierende Masse eine natürliche Trägheitsantwort liefern, besitzen umrichtergekoppelte Anlagen diese Eigenschaft nicht. Dennoch ist es möglich, Frequenzunterstützung durch gezielte Regelungsstrategien bereitzustellen, etwa in Form von virtueller Schwungmasse.
Resonanzphänomene, Reglerinteraktionen und elektrische Instabilitäten
Mit der Einführung der Klasse der Resonanzstabilität wird der Tatsache Rechnung getragen, dass in modernen Netzen nicht nur mechanische, sondern auch rein elektrische Resonanzen auftreten können. Elektrische Resonanzen – beispielsweise die Subsynchronous Control Interaction (SSCI) – treten vor allem in Verbindung mit DFIG-basierten Windkraftanlagen und Serienkondensatoren auf. Hierbei kann es zu ausgeprägten subsynchronen Strom- und Spannungsoszillationen kommen. Diese Phänomene stellen hohe Anforderungen an die Modellierungstiefe und erfordern häufig zusätzliche Dämpfungsmaßnahmen auf Regelungsebene.
Diese Stabilitätskategorie der Umrichterstabilität beschreibt instabile Systemzustände, die aus dynamischen Wechselwirkungen leistungselektronischer Regler mit dem Netz resultieren. Typische Symptome sind Frequenz- und Spannungsoszillationen oder Synchronisationsfehler. Maßnahmen zur Stabilisierung reichen von angepasster Reglerauslegung über aktive Dämpfungsstrategien bis hin zur Verstärkung der Netzanbindung.
Zukünftige Herausforderungen und Forschungsschwerpunkte
Die zunehmende technologische Durchdringung der Netze mit Umrichtertechnik und die damit einhergehenden Veränderungen in der Dynamik stellen große Herausforderungen an Analyse- und Betriebskonzepte. Künftige Forschung konzentriert sich auf die Entwicklung hybrider Systemmodelle, wobei auch in den Themenbereichen der „klassischen“ drei Stabilitätskriterien, Spannungs-, Frequenz- und Rotorwinkelstabilität noch Forschungsbedarf besteht.
Quellen:
[1], Hatziargyriou, N., Milanovic, J., Rahmann, C., Ajjarapu, V., Canizares, C., Erlich, I., ... & Vournas, C. (2020). Definition and classification of power system stability–revisited & extended. IEEE Transactions on Power Systems, 36(4), 3271-3281.