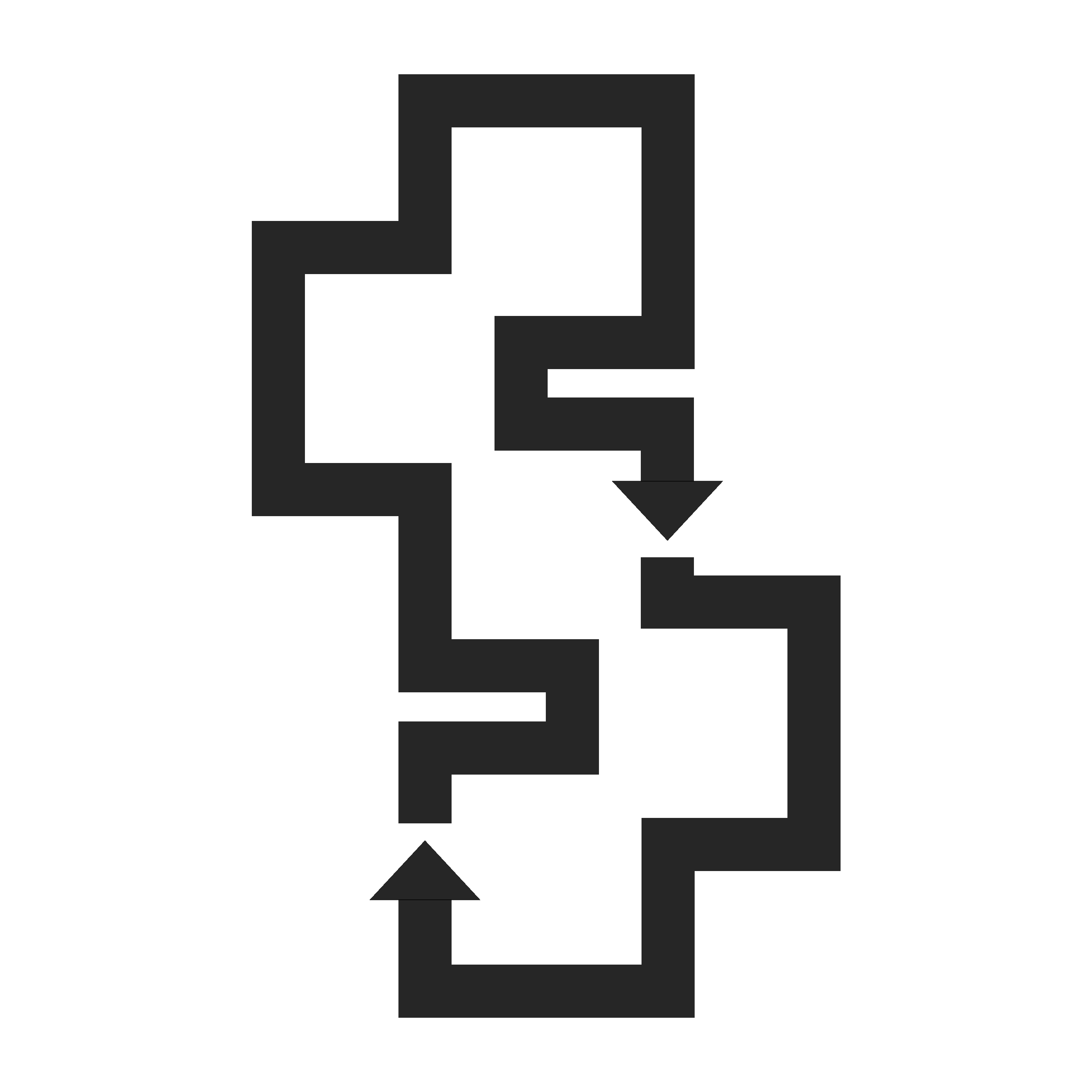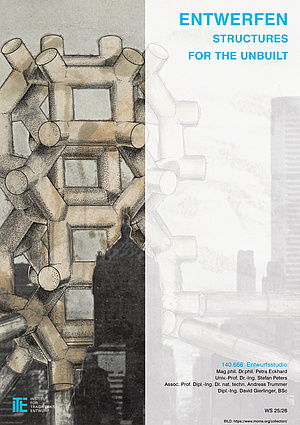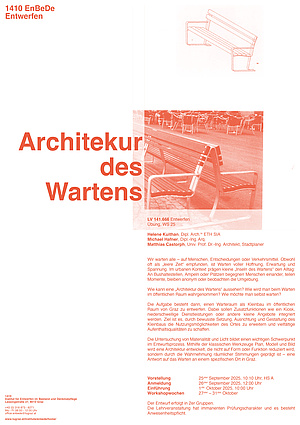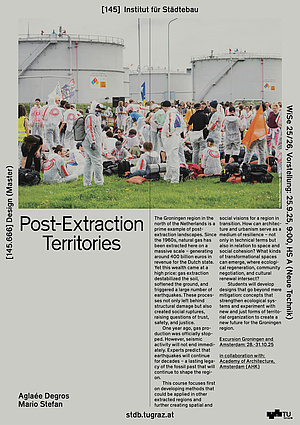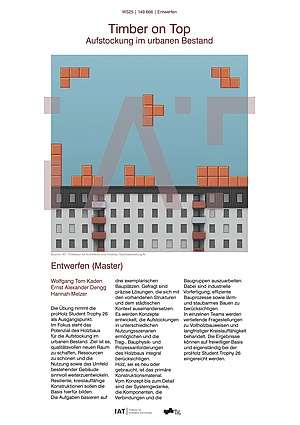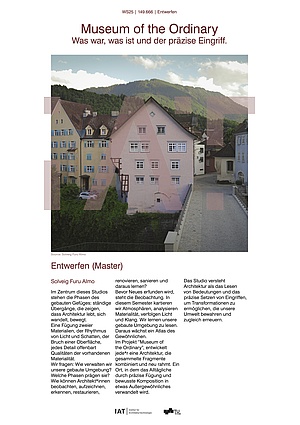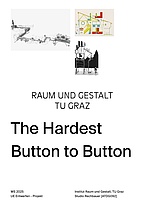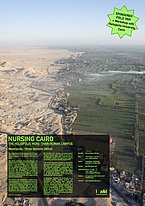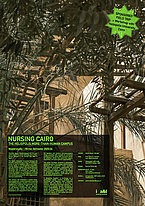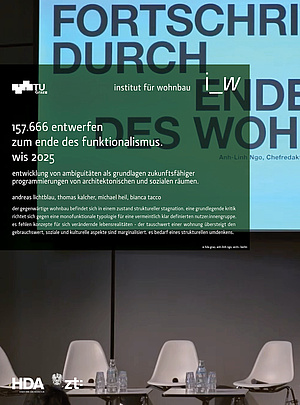Entwerfen (Master) im Wintersemester 2025/26
140.666 | Structures for the Unbuilt
Konzept und Leitung | Petra Eckhard,
Stefan Peters, Andreas Trummer,
David Gierlinger
Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie nehmen die Rolle des*r Tragwerksarchitekt*in und -ingenieur*in ein und bekommen die Möglichkeit Utopien, Skizzen und Wettbewerbsbeiträge von sehr bekannten Architekturbüros wie R. Abraham, Z. Hadid, oder H. Hollein aus der Zeit von 1950 bis 1990 weiterzuschreiben. Der Umfang des zugänglichen Materials sowie der Ausarbeitungsgrad variieren deutlich. Handskizzen, Präsentations- und Arbeitsmodelle halten das Maß der Ausarbeitung zum jeweiligen Zeitpunkt fest. Sie tauchen also in die Architekturwelt dieser Zeit ein, bringen aber auch die Werkzeuge und Fragestellungen aus dem Jahr 2025 mit. In diesem Spannungsfeld lernen Sie von Projekten, die nie verwirklicht wurden, und geben ihnen eine angemessene Struktur, die sowohl aktuelle Tendenzen der Entwurfsmethodik als auch Materialisierung beinhaltet. Die intensive Auseinandersetzung gilt dem Werk und dem Kontext aus Sicht der Architekturtheorie. Bautechnisch begeben wir uns nicht nur auf die Suche nach historischen Techniken und lokal verwurzelten Bauweisen, sondern auch nach technisch sinnvollen Lösungen, die das aktuelle Wissen abbilden. Zuletzt liegt ein angemessenes und überprüfbares Tragwerkskonzept vor, das bis hin zu den wichtigen Leitdetails ausgearbeitet ist.
141.666 | Architektur des Wartens
Konzept und Leitung | Matthias Castorph,
Michael Hafner, Helene Kuithan
Wir warten alle – auf Menschen, Entscheidungen oder Verkehrsmittel. Obwohl oft als „leere Zeit“ empfunden, ist Warten voller Hoffnung, Erwartung und Spannung. Im urbanen Kontext prägen kleine „Inseln des Wartens“ den Alltag: An Bushaltestellen, Ampeln oder Plätzen begegnen Menschen einander, teilen Momente, bleiben anonym oder beobachten die Umgebung.
Wie kann eine „Architektur des Wartens“ aussehen? Wie wird man beim Warten im öffentlichen Raum wahrgenommen? Wie möchte man selbst warten?
Die Aufgabe besteht darin, einen Warteraum als Kleinbau im öffentlichen Raum von Graz zu entwerfen. Dabei sollen Zusatzfunktionen wie ein Kiosk, niederschwellige Dienstleistungen oder andere kleine Angebote integriert werden. Ziel ist es, durch bewusste Setzung, Ausrichtung und Gestaltung des Kleinbaus die Nutzungsmöglichkeiten des Ortes zu erweitern und vielfältige Aufenthaltsqualitäten zu schaffen. Die Untersuchung von Materialität und Licht bildet einen wichtigen Schwerpunkt im Entwurfsprozess. Mithilfe der klassischen Werkzeuge Plan, Modell und Bild wird eine Architektur entwickelt, die nicht auf Form oder Funktion reduziert wird, sondern durch die Wahrnehmung räumlicher Stimmungen geprägt ist – eine Antwort auf das Warten an einem spezifischen Ort in Graz.
145.666 | Post-Extraction Territories
Konzept und Leitung | Aglaée Degros,
Mario Stefan
The Groningen region in the north of the Netherlands is a prime example of post-extraction landscapes. Since the 1960s, natural gas has been extracted here on a massive scale – generating around 400 billion euros in revenue for the Dutch state. Yet this wealth came at a high price: gas extraction destabilized the soil, softened the ground, and triggered a large number of earthquakes. These processes not only left behind structural damage but also created social ruptures, raising questions of trust, safety, and justice.
One year ago, gas production was officially stopped. However, seismic activity will not end immediately. Experts predict that earthquakes will continue for decades – a lasting legacy of the fossil past that will continue to shape the region.
This course focuses first on developing methods that could be applied in other extracted regions and further creating spatial and social visions for a region in transition. How can architecture and urbanism serve as a medium of resilience – not only in technical terms but also in relation to space and social cohesion? What kinds of transformational spaces can emerge, where ecological regeneration, community negotiation, and cultural renewal intersect? Students will develop designs that go beyond mere mitigation: concepts that strengthen ecological systems and experiment with new and just forms of territorial organization to create a new future for the Groningen region.
Link zur Lehrveranstaltung
Link zur Institutsseite
147.666 | An Empire of Fragments
Konzept und Leitung | Elisabeth Koller, Tobias Gruber, Emilian Hinteregger, Katharina Hohenwarter
„Fertig gibt es nicht. Es gibt kein Vorher oder Nachher, sondern es geht immer weiter“
– Oda Pälmke
Die Architektur der Nachkriegsjahrzehnte prägt das Bild unserer Städte in bislang kaum erfasstem Ausmaß – rund ein Viertel des gesamten Gebäudebestands stammt aus diesen Jahren. Die Gebäude haben ihren Glanz verloren – wirken heute wie Fragmente einer vergangenen Zeit – anonym und abgenutzt. Doch vielmehr noch haben diese Bauten Generationen, die in ihnen aufwuchsen, vorgeschrieben, wie man zu wohnen und zu arbeiten – zu leben hätte.
Im Masterstudio nehmen wir diesen Bestand auseinander und bauen ihn wieder zusammen – als materielle Ressource und architektonische Idee. Am Beispiel des Wohnhauses Billrothgasse 12 in Graz – errichtet in den 1970er Jahren für Krankenhauspersonal, zwischen Hotel- und Klosterarchitektur – suchen wir nach Strategien des Umbaus, testen neue und alte Typologien, entwerfen Architektur mit Aussage. Gearbeitet wird prozessorientiert und ergebnisoffen, mit klaren Methoden und Medien: Archiv, Fotografie, Text, Zeichnung und Modell.
149.666 | Das Leihgebäude. Dinge, Menschen und Vehikel
Konzept und Leitung |
Lukas Imhof, Patrick Pazdzior
Auf einer Brache, auf der in einigen Jahren ein Mix aus Wohnen, Gewerbe, Park und Verkehr bestehen wird, soll als ortsbaulicher Auftakt ein Leihgebäude geplant werden, eine Ergänzung für die geplanten Nutzungen. Ein Gebäude für Dinge und ihre Menschen.
Das Gebäude bietet Raum für jene Besitztümer und Tätigkeiten, die in kleinen Wohnungen keinen Platz mehr finden. Es kann verdichtetes Wohnen fördern und CO2-intensive Kellerräume reduzieren. Lagerabteile in verschiedenen Größen werden ergänzt von einem Verleih für Fahrzeuge und Dinge, die man zuweilen braucht, deren Anschaffung aber unsinnig ist.
Wir entwerfen nicht linear vom Städtebau zum Detail. Bilder verwenden wir als rekursives Entwurfs- und Konstruktionswerkzeug und oszillieren zwischen Maßstabsebenen, digitalen und analogen Arbeitsmitteln und zwischen verschiedenen Referenzen der Architekturgeschichte.
Mit Bild und Text suchen wir die Atmosphäre und setzen diese in konstruierbare Architektur um. Renderings, KI-generierte sowie händisch erstellte Bilder und ihr Gegenstück als Detailplanung machen Konstruktion und Ausdruck zum zentralen Thema und Begleiter im Entwurfsprozess. In diesem Semester wollen wir mit euch eine Sehschule durchlaufen und konstruktives Entwerfen als ein Hin und Her zwischen Maßstäben und Medien untersuchen.
149.666 | Timber on Top. Aufstockung im urbanen Bestand
Konzept und Leitung | Wolfgang Tom Kaden,
Ernst Alexander Dengg, Hannah Melzer
Die Übung nimmt die proHolz Student Trophy 26 als Ausgangspunkt. Im Fokus steht das Potenzial des Holzbaus für die Aufstockung im urbanen Bestand. Ziel ist es, qualitätsvollen neuen Raum zu schaffen, Ressourcen zu schonen und die Nutzung sowie das Umfeld bestehender Gebäude sinnvoll weiterzuentwickeln. Resiliente, kreislauffähige Konstruktionen sollen die Basis hierfür bilden.
Die Aufgaben basieren auf drei exemplarischen Bauplätzen. Gefragt sind präzise Lösungen, die sich mit den vorhandenen Strukturen und dem städtischen Kontext auseinandersetzen. Es werden Konzepte entwickelt, die Aufstockungen in unterschiedlichen Nutzungsszenarien ermöglichen und die Trag-, Bauphysik- und Prozessanforderungen des Holzbaus integral berücksichtigen.
Holz, sei es neu oder gebraucht, ist das primäre Konstruktionsmaterial. Vom Konzept bis zum Detail sind der Systemgedanke, die Komponenten, die Verbindungen und die Baugruppen auszuarbeiten. Dabei sind industrielle Vorfertigung, effiziente Bauprozesse sowie lärm- und staubarmes Bauen zu berücksichtigen. In einzelnen Teams werden vertiefende Fragestellungen zu Vollholzbauweisen und langfristiger Kreislauffähigkeit behandelt. Die Ergebnisse können auf freiwilliger Basis und eigenständig bei der proHolz Student Trophy 26 eingereicht werden.
149.666 | Museum of the Ordinary. Was war, was ist und der präzise Eingriff
Konzept und Leitung |
Solveig Furu Almo
Im Zentrum dieses Studios stehen die Phasen des gebauten Gefüges: ständige Übergange, die zeigen, dass Architektur lebt, sich wandelt, bewegt.
Eine Fügung zweier Materialien, der Rhythmus von Licht und Schatten, der Bruch einer Oberfläche, jedes Detail offenbart Qualitäten der vorhandenen Materialität. Wir fragen: Wie verwalten wir unsere gebaute Umgebung? Welche Phasen prägen sie? Wie können Architekt*innen beobachten, aufzeichnen, erkennen, restaurieren, renovieren, sanieren und daraus lernen? Bevor Neues erfunden wird, steht die Beobachtung. In diesem Semester kartieren wir Atmosphären, analysieren Materialität, verfolgen Licht und Klang. Wir lernen unsere gebaute Umgebung zu lesen. Daraus wächst ein Atlas des Gewöhnlichen.
Im Projekt „Museum of the Ordinary“, entwickelt jede*r eine Architektur, die gesammelte Fragmente kombiniert und neu rahmt. Ein Ort, in dem das Alltägliche durch präzise Fügung und bewusste Komposition in etwas Außergewöhnliches verwandelt wird. Das Studio versteht Architektur als das Lesen von Bedeutungen und das präzise Setzen von Eingriffen, um Transformationen zu ermöglichen, die unsere Umwelt bewahren und zugleich erneuern.
Link zur Lehrveranstaltung
Link zur Institutsseite
151.666 | The Hardest Button to Button
Konzept and Leitung | Büşra Köroğlu,
Justus Schmirler, Alex Lehnerer
In Florenz steht ein bemerkenswertes Bauwerk, fast 1000 Meter lang, und doch weitgehend unbekannt in seinem vollen Ausmaß. Die Rede ist vom Corridoio Vasariano, geplant im 16. Jahrhundert von Giorgio Vasari für die Medici als Verbindung und gegebenenfalls Fluchtweg zwischen deren Palazzo Vecchio und dem Palazzo Pitti. Nur ab und zu, in Form einer Überbrückung einer Gasse, zeigt dieses sich durch die Stadt schlängelnde Bauwerk seinen äußeren Ausdruck. Ansonsten bleibt es Hintergrund und nutzt bestehende Gebäude für seine Zwecke. Es ist ein zusammengesetztes Bauwerk (siehe auch Colin Rowe) und gleichzeitig in seiner Fragmentierung immer komplett. Es ist geplant, sieht aber nicht so aus. Ein Bauwerk so gut wie die Stadt selbst – das sich zwischen den Gebäuden bewegt, nicht nur über sie hinweg.
Vielleicht ist es gerade diese Unauffälligkeit, die ihm seine Kraft gibt. Nicht nur Repräsentation und Signifikanz, sondern auch Anschlussfähigkeit und Durchlässigkeit verflechten den Corridoio Vasariano eng mit der Stadt. Können wir Stadt und Architektur, also Text und Kontext, wieder enger zusammen(denken), wenn wir – wie bei Vasaris Korridor – diese sich entsprechende Haltung auf beide Felder anwenden? Auch die Stadt ist schließlich ein zusammengesetztes Bauwerk.
Um die Architektur nun vom einzelnen Objekt bis zur Stadt verstehen zu können, werden wir diese radikale florentinische Idee auch nach Graz importieren (auch Superstudio war schon mal in Graz) und ein zusammengesetztes Gebäude vom A1-Tower bis zur Herz-Jesu-Kirche bauen. Ein Raum in Serie, eine Verhandlung über Distanz. Jedes Projekt für sich, aber in seinen Einzelteilen doch ein kompletter Weg von 8020 nach 8010.
Übergange, Reaktionen, Ausweichmanöver – nicht strukturell, und wenn, nur hier und da – keine Megastruktur. Wie das geht, lernen wir beispielsweise von Filmen wie „The Swimmer“ (Columbia Pictures, 1968), in dem ein privater Swimming Pool nach dem anderen für den Hauptdarsteller Burt Lancaster einen Fluss bildet, und er so durch die Nachbarschaft nach Hause schwimmen kann. Auch sehen wir einen Hauch von nicht-struktureller Kontinuität in den Musikvideos von Michel Gondry (z.B. The White Stripes: The Hardest Button to Button, 2003).
153.666 | Nursing Cairo: The Heliopolis More-Than-Human Campus
Konzept und Leitung | Klaus K. Loenhart,
Patrik Drechsler
This IA&L Master Studio engages with the real-world task of the future Heliopolis More-Than-Human Campus in the famous Nile delta in Egypt.
This future Heliopolis University Campus will become a living example of how our world may evolve in true co-habitation with a more-than-human reality. In an exceptional cooperation with the SEKEM Initiative and during extensive Workshop days with students from Heliopolis University, we re-imagine the typology of university campus as a nursing and nurturing community within a living imaginary of human and natural ecosystems for care, regeneration, and true sustainability.
This campus will emphasize a holistic living-learning approach, combining academic learning with practical projects, research, and community engagement to address environmental, social, and economic challenges. With our approach we will develop architectures that are highly sensitive to their climate, more-than-human ecosystems, and responsive to their resources.
We therefore will combine biometeorological design principles with concepts for communal activities of care, which offer nurturing spaces for reflection, retreat, new economies, organic encounters, and socio-political responsibility.
This studio therefore proposes a speculative spatial intervention that engage multi-contextual dynamics and scalarities. From nurturing and learning landscapes, regenerative food production, ecological regeneration up to layers of social engagement — we will develop an architectural campus design that unfold in its deep geographical, socio-cultural and environmental interconnection.
In designing “together” in Co-Design as a participative design method, students will coordinate and negotiate their respective projects with one another to co-create a coherent, diverse and functional campus. This experience is geared towards developing a critical understanding of how architectural design can be engaged to address ecological issues, promote sustainability, and create meaningful spaces for both human and more-than-human cohabitation.
157.666 | Zum Ende des Funktionalismus
Konzept und Leitung | Andreas Lichtblau,
Thomas Kalcher, Michael Heil, Bianca Tacco
Der gegenwärtige Wohnbau befindet sich in einem Zustand struktureller Stagnation. Ein weitgehend starres System reproduziert sich in eingefahrenen Entscheidungsmustern, die in Summe zu uniformierten, monofunktionalen Lösungen führen. Die Resultate gleichen sich nicht nur formal, sondern vor allem im konzeptionellen Grundverständnis von Wohnen, von Produktion und Reproduktion, von zutiefst funktionalistischem Verständnis. Eine grundlegende Kritik richtet sich gegen dieses funktionalistische Denken, dass eine Wohnbautypologie monofunktional eine vermeintlich klar definierte Nutzer*innengruppe bedienen muss. Insbesondere gemeinschaftliche Wohnformen oder alternative Lebenskonstellationen finden in diesem System kaum Berücksichtigung. Zugleich fehlen in diesem Modell sowohl Konzepte für Fürsorge- und Betreuungspflichten als auch flexible Wohnmodelle, die sich an veränderte Lebensrealitäten anpassen lassen. Im Hinblick auf eine sich maßgeblich verändernde Altersstruktur ein wesentlicher Faktor. Ferner erweist sich das bestehende „System-Wohnbau“ vorwiegend als Geschäftsmodell für gemeinnützige Bauvereinigungen – nicht als Werkzeug für eine sozialräumlich reflektierte Architektur. Weit weg von dem ursprünglichen Genossenschaftsgedanken der Hilfe zur Selbsthilfe, zur Linderung höchst prekärer Wohnungsnöte. Die ursächliche soziale Aufgabe spielt keine Rolle mehr im Eigenverständnis der Stakeholder. Vielmehr geht es um Grundstücksspekulationen und das „Bedienen des Marktes“. Der Tauschwert einer Wohnung übersteigt den Gebrauchswert, soziale und kulturelle Aspekte sind marginalisiert. Es bedarf daher eines strukturellen Umdenkens. Wir am i_w beschäftigen uns intensiv mit dieser interdisziplinären Frage nach der Ursache dieser Entwicklung und seinen Auswirkungen auf den gebauten Raum. Und vor allem beschäftigen wir uns mit dem Entwickeln einer Gegenposition zu dieser monofunktionalen Programmatik, die in einer äußerst konservativen Weise vorangetrieben wird.