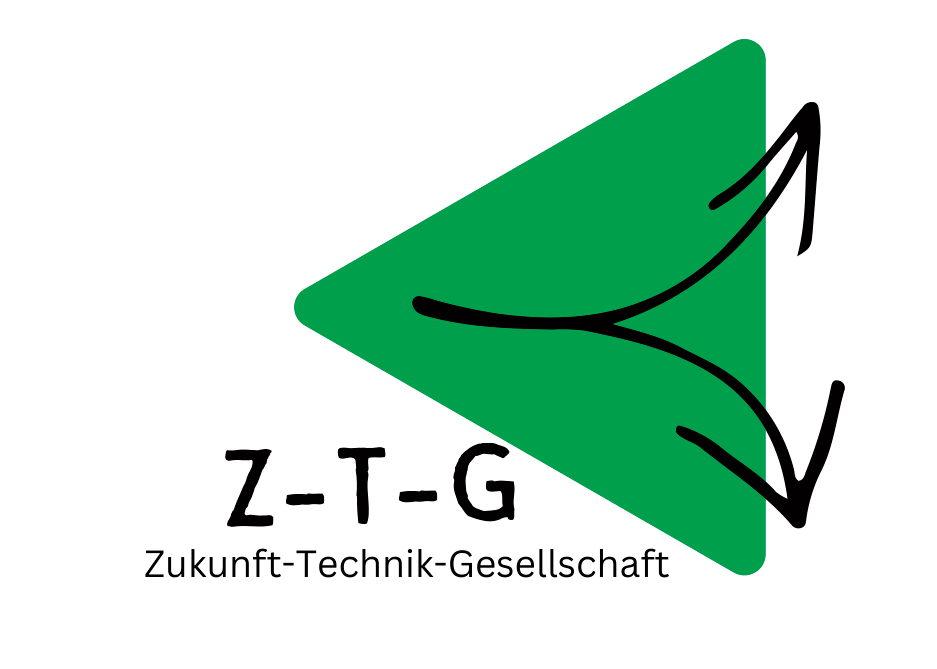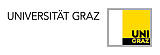Kohlenstoffmanagement in einer Kreislaufwirtschaft: Potenziale und Zukunftspfade für die Steiermark (Z-T-G 003)
Das global verfügbare Kohlenstoffbudget zur Einhaltung der Pariser Klimaziele wird zusehends knapper und viele verschiedene Entwicklungspfade können aufgezeigt werden, wie diese Budgetrestriktion eingehalten werden kann. Manche dieser Zukunftspfade beinhalten technische und naturbasierte Optionen, die Treibhausgase (THG) daran hindern, in die Atmosphäre zu gelangen, und dadurch weiteren Strahlungsantrieb vermeiden. Dieses Projekt zielt auf die verschiedenen Möglichkeiten ab, wie mit THG systematisch umgegangen werden kann, und verknüpft diese mit strategischen und kreislaufwirtschaftlichen Überlegungen für die steirische Forschungs- und Entwicklungsgemeinschaft sowie für industrielle Anwendungen.
Die technische Abscheidung von THG kann direkt an der Emissionsquelle (carbon capture) oder indirekt an der atmosphärischen Immissionssenke (direct air capture) erfolgen. Anschließend kann eine Speicherung in geologischen Formationen stattfinden, wobei in Österreich derzeit dafür ein Moratorium für kommerzielle Zwecke besteht. Derlei Optionen werden zurzeit in österreichischen Forschungsprojekten verfolgt, wobei diese über die Speicherung (CCS “carbon capture and storage”) hinausgehen. Die geologische Zwischenspeicherung von THG wird als Integrationsdienstleistung für volatile erneuerbare Energieformen verfolgt (RAG, „Underground Sun Conversion“), wodurch man THG in wertschöpfende Nutzungsformen überführt (CCU, “carbon capture and usage”) und dadurch einen kreislaufwirtschaftlichen Ansatz etabliert. Österreichische CCU-Ansätze gibt es in der (jeweils sektorenübergreifenden) Zement- (Lafarge, Verbund, OMV, Borealis - C2PAT) als auch Abfallwirtschaft (OMV, ReOil). Naturbasierte Ansätze, wie zum Beispiel Aufforstung, und Bioenergienutzung in Kombination mit Kohlenstoffabscheidung (BECCs), stellen weitere Optionen dar, die sogar über Netto-Null hinausgehen und negative Emissionen erlauben würden (z.B. bei thermischer Nutzung von Holz, Abscheidung des dabei entstehenden CO2, in Kombination mit nachhaltiger Wiederaufforstung). Zudem wird zurzeit auch die Nutzung von festem Kohlenstoff (als Nebenprodukt in Pyrolyseverfahren zur Wasserstoffherstellung) durch Ausbringung in landwirtschaftlichen Böden und als Beimengungs-Komponente in Baumaterialen wie Ziegel und Beton von verschiedenen wissenschaftlichen Akteur:innen in Österreich beleuchtet.
Ziel des Projektes ist es, die international und in Österreich bereits verfolgten Entwicklungsoptionen für Kohlenstoffmanagement gesamthaft darzustellen und deren wichtigste Stakeholder:innen entlang der Wertschöpfungskette zu verorten, mit besonderem Fokus auf in der Steiermark angesiedelte. Die Bedeutung dieser Entwicklungsoptionen für den Themenbereich des Kohlenstoffmanagements und seiner effektiven Regulierung soll dabei herausgearbeitet werden. Das Projekt verfolgt dafür folgende Forschungsfragen:
- Welche technischen und naturbasierten Ansätze des Kohlenstoffmanagements sind für die Steiermark heute und in Zukunft relevant?
- Welche Potenziale der relevanten Ansätze des Kohlenstoffmanagements gibt es in der Steiermark?
- Welche Zukunftspfade für das Kohlentstoffmanagement vor dem Hintergrund der Kreislaufwirtschaft können abgeleitet werden?
- Welche Akteur:innen und institutionelle Strukturen (lokale und nationale politische Akteure, Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Regulierungen etc.) spielen eine zentrale Rolle in der Realisierung zukünftiger Pfade für das Kohlenstoffmanagement?
- Welche Handlungsempfehlungen können für das Kohlenstoffmanagement in der Steiermark abgeleitet werden?
Um die Entwicklungsoptionen für ein Kohlenstoffmanagement in der Steiermark darzustellen wird ein Participatory Systems Mapping Ansatz mit einer Cross-Impact Analyse kombiniert, um so Innovationssysteme für das Kohlenstoffmanagement darzustellen, mögliche soziotechnische Kippelemente zu identifizieren und Zukunftspfade abzuleiten.
Projektteam
Universität Graz, Wegener Center for Climate and Global Change
- Karl Steininger (Koordination)
Univ.-Prof. Mag. Dr.rer.soc.oec. - Raphaela Maier
BSc MSc
TU Graz, Institute of Human-Centred Computation, STS--Science, Technology and Society Unit
- Christian Dayé
Mag. Dr. phil.
Universität Graz, Institut für Umweltsystemwissenschaften
- Michael Kriechbaum
MSc PhD - Peter Obersteiner
BA MSC
Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl Energieverfahrenstechnik
- Markus Lehner
Univ.-Prof. DI Dr.-Ing. - Philipp Wolf-Zöllner
Dipl.-Ing.
Fördergeber
Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung
Laufzeit
Beginn: 01.10.2023
Ende: 31.03.2025
Raphaela Maier, Universität Graz
Christian Dayé, TU Graz
Markus Lehner, Montanuniversität Leoben