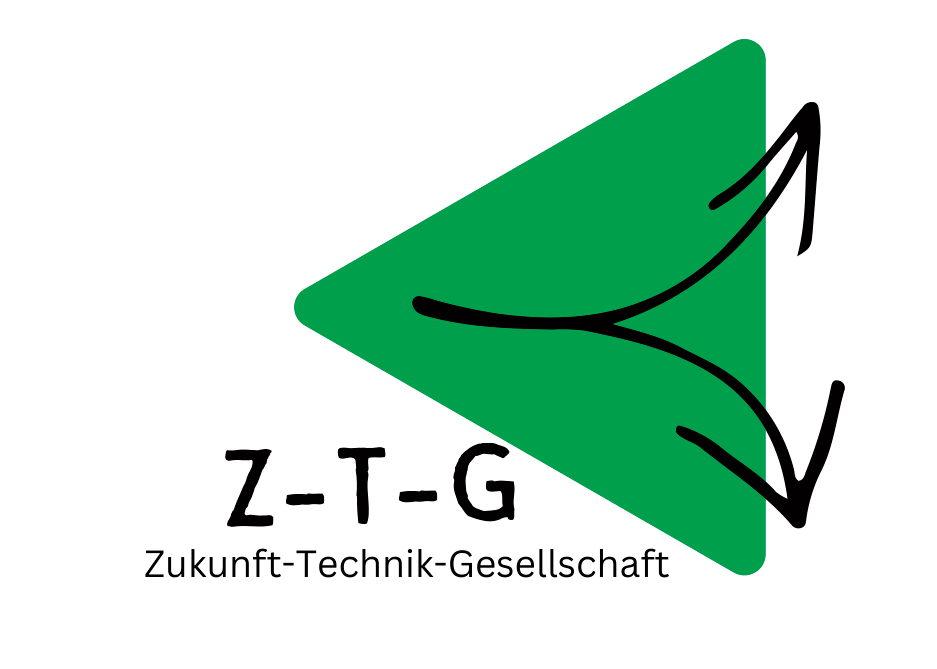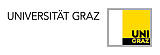Wasserstoff und die Steiermark: Regionale Handlungspfade im Kontext internationaler Technologieentwicklung (Z-T-G 002)
Obwohl die Vision einer Wasserstoffwirtschaft bereits seit mehreren Jahrzehnten erforscht und diskutiert wird, sind die Erwartungshaltungen bezüglich der Nutzung wasserstoffbasierter Technologien im Rahmen der internationalen Bemühungen zur Begrenzung des menschengemachten globalen Klimawandels signifikant angestiegen. So spricht die Internationale Energie Agentur (IEA) von einer „noch nie dagewesen Wachstumsdynamik“ im Bereich der Wasserstofftechnologien und multi-nationale Unternehmen, wie zum Beispiel Toyota, Bosch oder Siemens, sehen Wasserstoff als den Wachstumstreiber der kommenden Jahrzehnte. Darüber hinaus verabschieden immer mehr Länder nationale Wasserstoff-Strategien, in der angestrebte Ausbaupfade dargelegt werden.
Vor diesem Hintergrund werden in diesem Projekt die Möglichkeiten, die sich für den steirischen Raum in Bezug auf die vermehrte Wasserstoffnutzung (und den damit verbundenen R&D&I Aktivitäten) bieten, untersucht. Wie in grundsätzlich allen Prozessen soziotechnischen Wandels, treffen bei der Nutzung von Wasserstoff unterschiedliche Logiken – und somit verschiedene Zukunftsvorstellungen – aufeinander. Diese systematisch zu kartographieren und kritisch mit Überlegungen der Realisierbarkeit zu konfrontieren, ist das Ziel dieses Projekts. Zentrales Ergebnis ist demnach die Beschreibung und Bewertung potenzieller Zukunftspfade für den steirischen Raum sowie die Gegenüberstellung dieser mit laufenden R&D&I Aktivitäten sowie mit Entwicklungen im größeren Kontext (Österreich, EU, global). Die Ergebnisse dieses Forschungsprojekts können in weiterer Folge als Grundlage für die kontinuierliche Gestaltung einer steirischen Zukunftsstrategie im Bereich Wasserstoff herangezogen werden.
Konkret werden folgende Fragen behandelt:
- Welche unterschiedlichen Schwerpunkte setzen die weltweit mittlerweile 40 nationalen Wasserstoffstrategien?
- Wie lässt sich das Zusammenwirken internationaler Entwicklungen beschreiben und in seinen Folgen – ökonomisch, gesellschaftlich, ökologisch – abschätzen?
- Welche Synergien zwischen potentiellen Zukunftspfaden im Bereich Wasserstoff und den steirischen F&E&I Aktivitäten lassen sich identifizieren?
- Was braucht es angesichts der absehbaren internationalen Entwicklungen, damit sich die Steiermark nachhaltig im internationalen Geschehen etablieren kann?
Um diese Fragen zu beantworten, werden zwei Forschungsstränge zunächst parallel begonnen und gegen Ende des Projekts zusammengeführt. Forschungsstrang A fokussiert auf internationale Entwicklungen. Hier wird zunächst (i) eine vergleichende Analyse aller nationalen zum Stichtag 1. Juni 2023 verabschiedeten nationalen Wasserstoffstrategien durchgeführt. Aus dieser Analyse erhalten wir eine Typologie von Strategien, Wasserstoff-Visionen und Entwicklungspfaden. Diese Typologie sowie weitere Ergebnisse dieser Analyse werden (ii) einer Gruppe internationaler Stakeholder zugänglich gemacht, die ersucht werden, auf dieser Grundlage und ihrer eigenen Expertise narrative Szenarien über die globale Situation des Wasserstoffs im Jahr 2040 zu verfassen. Über diese narrativen Szenarien erhalten wir Abschätzungen über das Zusammenwirken von nationalen Strategien, Marktverschiebungen und sonstiger geopolitischer und wissensökonomischer Dynamiken. In einem an die Szenariengenerierung anschließenden (iii) Delphi-Prozess werden diese Szenarien interaktiv bewertet, synthetisiert und auf eine angepeilte Anzahl von drei Szenarien reduziert, die dann im weiteren Verlauf als mögliche internationale Entwicklungen auf ihre Bedeutung für den Standort Steiermark hin analysiert werden.
Forschungsstrang B hingegen fokussiert auf die Steiermark. Ausgehend von einer (i) Analyse der steirischen Stakeholder wird ein (ii) Participatory Systems Mapping durchgeführt. In diesem Ansatz werden die freiwillig teilnehmenden Stakeholder eingeladen, ihr mentales Bild des steirischen Innovationssystems Wasserstoff visuell in Form eines Mappings darzustellen und dabei auch auf die ein- oder wechselseitigen Abhängigkeiten einzugehen.
Die abschließende Projektphase dient der Zusammenführung der beiden Forschungsstränge mit dem Ziel, den aktuellen Standort des steirischen Innovationssystems Wasserstoff im internationalen Kontext zu bestimmen und angesichts der kommenden Entwicklungen mögliche Entwicklungspfade aufzuarbeiten und strategisch zu evaluieren.
Projektteam
TU Graz, Institute of Human-Centred Computation, STS--Science, Technology and Society Unit
- Christian Dayé (Koordination)
Mag. Dr. phil. - Peter Obersteiner
BA MSC - Christina Auer
BSc
Universität Graz, Institut für Umweltsystemwissenschaften
- Michael Kriechbaum
MSc PhD
Universität Graz, Wegener Center für Klima und globalen Wandel
- Karl Steininger
Univ.-Prof. Mag. Dr.rer.soc.oec. - Raphaela Maier
BSc MSc
HyCentA Research GmbH
- Franz Winkler
DI Dr. techn. - Martin Sagmeister
DI Dr. techn., BA
Fördergeber
Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung
Laufzeit
Beginn: 01.07.2023
Ende: 30.12.2024
Christian Dayé, TU Graz
Michael Kriechbaum, Universität Graz
Martin Sagmeister, HyCentA