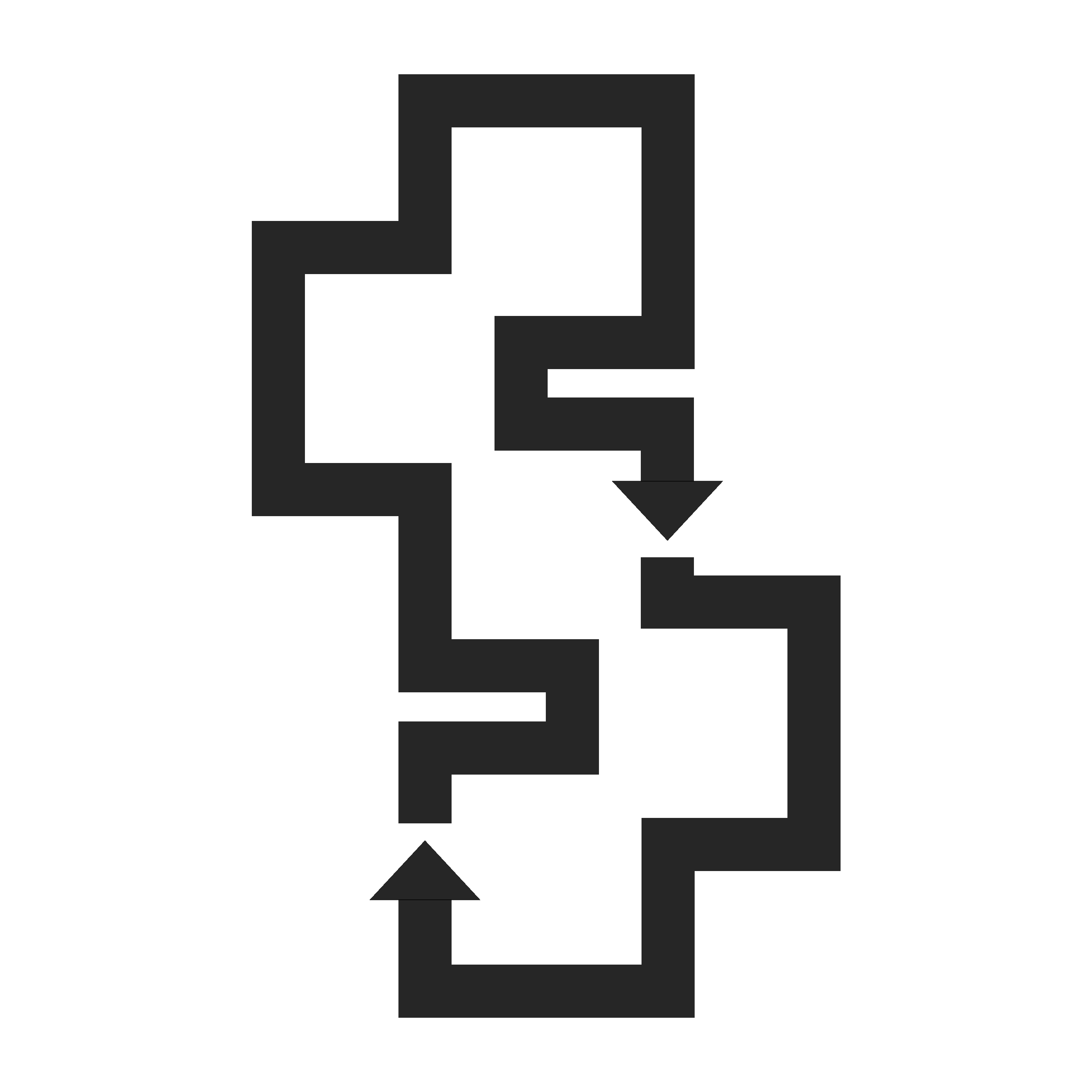„Nichts könnte ich schlimmer finden als Architektur mit einer Handschrift“
Lukas Imhof (LI) im Gespräch mit Petra Eckhard und Daniel Gethmann (GAM)

GAM: Herzlich willkommen an der TU Graz, Lukas Imhof. Du bist hier als Professor für Hochbau und Entwerfen im Oktober 2024 berufen worden und nun auch der Leiter des Instituts für Architekturtechnologie. Gleichzeitig betreibst du ein Architekturbüro in Zürich, Lukas Imhof Architektur, das 2004 gegründet wurde. Vor deiner Berufung hast du zehn Jahre als Lehrbeauftragter an der Hochschule Luzern am Institut für Technik und Architektur unterrichtet. Was war dort dein Schwerpunkt?
LI: Ein Entwurfsstudio mit unterschiedlichem Fokus. Wir führten ein interdisziplinäres Projektmodul mit Entwurfsgruppen von 4-5 Studierenden aus den Disziplinen Architektur, Innenarchitektur, Gebäudetechnik und Statik. Auch das Lehrteam war aus diesen Disziplinen zusammengesetzt. Das war von Anfang an sehr interdisziplinär angelegt – zunächst fand eine interdisziplinäre Blockwoche statt, während der sich die Studierenden der unterschiedlichen Disziplinen auf eine Entwurfsthese und eine interdisziplinäre Zielvereinbarung zur Nachhaltigkeit einigen mussten. Die interdisziplinäre Gruppe blieb das ganze Semester zusammen – nur die letzten Wochen waren je einer disziplinären Vertiefung gewidmet.
Ein anderes Modul, das ich zusammen mit Pascale Bellorini entwickelt und geführt habe, war stärker auf die atmosphärische Dimension von Architektur ausgerichtet. Es entstand dabei ein Entwurf anhand eines bestehenden Raums. Wir haben sehr spezifische Räume als Ausgangslage definiert – zum Beispiel Bar-Räume oder Sakralräume. Die Studierenden haben sich dann zunächst in Textform und mittels Photographie den Räumen angenähert. Wir haben dazu mit einem Architekturphotographen, Rasmus Norlander, zusammengearbeitet, der die photographische Dokumentation des Raums begleitet hat. Die Textarbeit wurde vom Architekten und Autor Christoph Ramisch begleitet. Die Studierenden haben danach den bestehenden, analysierten Raum digital 3D modelliert und gerendert. So haben sie den Raum in verschiedenen Dimensionen wirklich gut verstanden. Am Schluss haben sie auf dieser Grundlage eine räumliche, materielle oder inhaltliche Manipulation des Raumes erarbeitet.
GAM: Du hast mit 20 Jahren an der ETH Zürich das Architekturstudium begonnen. Aus welcher Motivlage heraus?
LI: Ich habe mit 16 Jahren in der Schulbibliothek meines Gymnasiums die Le Corbusier Monographie von Stanislaus von Moos entdeckt und gedacht, mal schauen, wer das war. Ich habe das Buch dann gelesen und fand diese architektonische Geschichte faszinierend. Nach diesem Buch wollte ich Architekt werden – und habe danach auch nie mehr darüber nachgedacht, ob ich etwas anderes werden soll.
GAM: Wer hat dich im Studium geprägt? Du hast ja unterschiedliche Lehrer*innen gehabt.
LI: Das ist richtig. Flora Ruchat-Roncati war eine der ersten prägenden Figuren. Ihre Person und ihre Art über Bau, Territorium und Ort nachzudenken und zu reden, haben mich fasziniert. Weiter war Arthur Rüegg wichtig, weil er so ein akribischer Forscher zu den Konstruktionsweisen der Moderne war. Sein Wissen und Können haben mich beeindruckt. Und schließlich natürlich Miroslav Šik, der mein wichtigster Lehrer in der Schule wurde. Er vermittelte eine sehr enge Verbindung von Geschichte und Nutzung, Entwurf und Konstruktion. Man weiß das vielleicht ein bisschen zu wenig, denn man kennt vor allem seine riesigen Bilder und diese schöne Art der Visualisierungen – aber jedes Bild musste immer hinterlegt werden mit einer Konstruktion. Zu jeder Visualisierung gab es einen 1:20 oder 1:50 Plan; es hat ihn nie nur das Bild interessiert, sondern immer auch, wie man das macht. Damit, und auch mit seiner Menschlichkeit, wurde er die prägendste Figur meines Studiums. Und danach habe ich ja auch bei ihm gearbeitet.
GAM: Du hast in seinem Büro gearbeitet nach dem Studium?
LI: Genau, ich habe zweieinhalb Jahre in seinem Büro gearbeitet und dann acht Jahre an seinem Lehrstuhl an der ETH.
GAM: Da warst du erst Assistent, Forschungsassistent und danach Oberassistent, das ist in der schweizerischen Hierarchie eine Stufe höher. Was hast du als Forschungsassistent gemacht?
LI: Forschung bedeutete in meinem Fall schreiben, also über Architektur schreiben. Nach einer Arbeit über Architekturvisualisierungen habe ich Midcomfort entwickelt und daraus ein Buch gemacht, später dann an einem Buch über Miroslav Šik als Lehrer gearbeitet.
GAM: Welche These hast du in Midcomfort vertreten?
LI: Die These, dass es eine Art Reformtradition in der Architektur gibt, die – ungebrochen durch die Moderne – immer bestanden hat und die es in der modernen Architekturgeschichte immer gab. Diese Architektur, die wir als Reformarchitektur zusammenfassen und die der spektakulären Disruption der Moderne eine stetige Weiterentwicklung der Architektur entgegensetzt, hat in den letzten 120 Jahren stets gelungene Resultate hervorgebracht. Reform-Wohnbauten, etwa aus den 1910er-Jahren, sind bis heute beliebt und werden gerne bewohnt. Die These von Midcomfort ist, dass diese vielfältigen Strömungen nie ganz verschwunden waren, dass man am Bewährten weiterarbeiten und das Neue in verständlichen Schritten untermischen kann. Man sieht es an der ganz banalen Behauptung, dass die meisten von uns lieber in Altbauten wohnen als in Neubauten. Die Behauptung ist nicht ganz richtig, sie ist ein bisschen polemisch, ein bisschen banal – aber trotzdem sind viele doch gerne in der Altbauwohnung, gerade wenn sie nicht architektonisch „gebildet“ sind. In Midcomfort behaupte ich nicht, dass man diese historischen Wohnungen weiterhin so bauen kann oder soll. Aber ich frage mich: Woher kommt diese Zuneigung zu Räumen in Altbauten? Und wie kann man den Komfort einer Altbauwohnung in einen Neubau, in eine heutige Architektur transformieren? Wie kann man das integrieren, was an Lebensreform, an gesellschaftlichem Wandel, an neuen Lebensformen dazugekommen ist seit den 1910er-Jahren? Zum Beispiel das Thema Freizeit und der Bezug zur Natur, im Wohnungsbau etwa abgebildet in der Benutzung von privaten Außenräumen. Auch die Benutzung der Küche und das Verhältnis zum Kochen hat sich zum Glück stark verändert. Hier frage ich in Midcomfort: Wie können heutige Bedürfnisse und die Qualitäten älterer Wohnungen zusammengebracht werden? Ein Beispiel: Patchwork-Familien funktionieren ja oft ganz gut in einem Altbau. Welche Eigenheiten einer Altbauwohnung machen es aus, dass dem so ist? Schaltbare Zimmer in ähnlicher Größe etwa, die unterschiedlich bespielt werden können. Manchmal muss man ja die Dinge gar nicht neu erfinden, nur weil sich die Welt geändert hat. Manchmal ist ja die konventionelle Architektur für neue Bedürfnisse auch noch gut – denn ein Schlafzimmer ist ein Schlafzimmer, da schläft man halt und macht gern die Tür zu. Und wenn man es dann mit einer Doppelflügeltüre dem Wohnraum zuschlagen oder es als Homeoffice nutzen kann, hat man die Nutzungsflexibilität, welche die Moderne oft gesucht hat, mit einfachsten Mitteln. Was also muss man wirklich neu machen und was kann man im Bewährten als Qualitäten finden? Wo kann man auch die neuen Anforderungen mit den Qualitäten des Bestehenden, des Historischen oder Konventionellen weiterentwickeln, verknüpfen und ein bisschen neu konfigurieren? Nicht, um historisierend zu sein, sondern um die bewährten Qualitäten des Historischen in die heutige Zeit zu übertragen. Das war so der ungefähre Forschungsansatz.
GAM: Und gleichzeitig hast du mal gesagt, dass das Buch auch eine Polemik ist. Die Polemik richtet sich ganz stark gegen die Moderne.
LI: Ja, das ist richtig. Weil die Moderne halt in Vielem versagt hat; das kann man, glaube ich, rückblickend so sagen. Sie ist nach wie vor – abgesehen vom modernistischen Häuschen, denn Einfamilienhäuser werden ja heute teilweise „im Bauhausstil“ bestellt – in großen Teilen der Welt und der Bevölkerungen ungeliebte Architektur. Es wurde in der Realität ein autofreundlicher, funktionalistischer Städtebau, der oft nicht besonders geschätzt wird. Man kann das aus der Sicht von heute bewerten und sich überlegen: was kann man davon gebrauchen und was eher nicht. Die Polemik war aber eher dagegen, dass heute noch für viele als modern gilt, was in den 1920er-Jahren entwickelt wurde. Diese Art der Moderne, die oft „klassische Moderne“ genannt wird, ist nun schon 100 Jahre alt, und heute noch in dieser Art zu bauen ist nichts anderes als ein neuer Historismus, eine historisierende Herangehensweise in der Architektur. Das war vielleicht, als ich das Buch geschrieben habe, vor 10, 15 oder 20 Jahren noch prägender für die Architektur als heute. Die „klassische Moderne“ war das, was an der Architekturschulen vermittelt und gelehrt wurde. Das hat sich seitdem auch ein bisschen entschärft. Ich schreibe in Midcomfort gegen diese unkritische Rezeption der Moderne. Und es wird dann schon eine Polemik, wenn ich die These aufstelle, dass sich die modernistischen Architekt*innen selten wirklich um die Bedürfnisse der Leute gekümmert haben, sondern in erster Linie um ihre Architektur und wie sie sich darin verwirklichen können – bis hin zu einer eigenen Handschrift – und nichts könnte ich schlimmer finden als Architektur mit einer Handschrift: Ich habe da was gebaut, es sieht nach mir aus und ihr müsst jetzt drinnen wohnen. Und das war natürlich auch das Ziel dieser Polemik: Architekt*innen, die Architektur um ihrer selbst willen machen, ihrer Handschrift den Vorzug vor dem Wohnkomfort geben und die Bedürfnisse der Bewohner*innen nie ganz ernst nehmen.
GAM: Aber was wäre denn der Unterschied, wenn sich jetzt die Studierenden deine Architektur anschauen und sagen: Lukas Imhof Architektur hat eine Handschrift. Dann würdest du ja sagen…
LI : Hoffentlich nicht.
GAM: Hoffentlich nicht. Bitte erklär uns, was an der Handschrift-Definition so schlimm ist. Ist Handschrift für dich so etwas wie Uniformität im Ausdruck?
LI: Genau, eine persönliche Uniformität, die von einer Autorin oder einem Autor geschaffen wird, sodass das Gebäude z. B. sagt, ich bin ein Zaha-Hadid-Gebäude, egal wo es steht und egal welchem Zweck es dient. Das ist das, was ich mit Handschrift meine. Ein Gebäude soll nicht sagen: Ich bin ein Werk von dieser oder jener Person, sondern es soll erstmal ganz viel sagen über die Nutzung, die Stadt, den Ort, die Bewohner*innenschaft – und wenn dann am Schluss noch irgendwo ein ovales Fenster ist, weil die Architektin oder der Architekt das gerne mag, dann ist das auch nicht schlimm. Aber das ist eher die kleine Signatur unten rechts, um das Bild abzuschließen – aber niemals eine große Signatur, in die Stadt hineingemalt.
GAM: Inwiefern hast du diesen Ansatz, den du in deiner Forschung in der Vergangenheit verfolgt hast, in deine Arbeit im Büro integriert?
LI: Die Arbeit im Büro ist natürlich geprägt von dieser Geisteshaltung. Aber sie ist auch – zum Glück, muss ich sagen – nicht eine ganz direkte Umsetzung von Midcomfort. Das Buch war sehr stark auf das Wohnen fokussiert und wir haben im Büro aus verschiedenen Gründen lange wenig Wohnungsbau gemacht bzw. machen können, sondern vielmehr Schulbauten oder Kindergärten und auch Industriebauten, zum Beispiel Kläranlagen. Es ist ganz gut, dass ich nicht nach Jahren des Nachdenkens und der Forschung ein Buch schreibe – und dann hingehe und das eins zu eins umsetze. Es war ganz gut, dass erstmal zehn Jahre vergangen sind, wo ich etwas anderes gemacht habe. Erst in letzter Zeit haben wir dann das Glück gehabt, dass wir ein wenig Wohnungsbau machen konnten. Der Lindenhof im Thurgau ist so ein Gebäude, in das Gedanken von Midcomfort eingeflossen sind. Es ist ein Wohnungsbau, der vieles zulässt, aber zu einer gemeinschaftlichen Lebensform anregen soll. Die Bewohner*innen werden aber nicht gezwungen, gemeinschaftlich zu leben – sondern eher ein bisschen animiert, sich kennenzulernen und sich zu begegnen. Sie können sich dann aber auch zurückziehen. Das ist natürlich schon geprägt von der Gedankenwelt aus Midcomfort, ohne dass eine direkte Ableitung da ist.
GAM: Und was hat verhindert, dass du das Buch an der ETH als Dissertation abgibst?
LI: Also, zum einen muss man sagen, dass damals an der ETH sehr wenig Dissertationen gemacht wurden, in der Architektur eigentlich gar keine. Das war sehr unüblich. Höchstens im Bereich der Architekturgeschichte wurden Doktorarbeiten verfasst, aber sonst gab es das Thema der Dissertation bei Assistierenden nicht. Darum habe ich auch gar nie darüber nachgedacht. Ich hätte vermutlich sehr viel wissenschaftlicher arbeiten müssen, während das Buch nun in vielem persönlich geprägt ist, auch mal eine Behauptung aufstellt und sehr viele Gebiete der Architektur anschneidet, ohne sie auf eine Art zu durchdringen, wie das in einer wissenschaftlichen Arbeit nötig wäre. Und schließlich war für mich das Resultat wichtig: Es war nun dieses Buch in der Welt und es wurde wahrgenommen und diskutiert, und ob ich damit Doktor wurde oder nicht, das hat mich weniger interessiert als seine Wirkung. Das ist vielleicht ein Punkt – und zum anderen war die ETH damals sehr praxisbezogen, die Professor*innen der Entwurfslehrstühle kamen allesamt aus der Praxis, das hat den Diskurs stark geprägt.
GAM: Was von diesen ganzen Lebenserfahrungen wird in deine Lehre an der TU Graz einfließen? Wie stellst du dir die Lehre und ihre Ausrichtung an so einem großen Institut wie dem IAT vor?
LI: Ich habe hier natürlich jetzt ein wirklich fantastisches Institut übernommen mit einer gewissen Kraft und ich möchte das sehr stark in Richtung Nachhaltigkeit, also konstruktiver und gestalterischer Nachhaltigkeit, betreiben, damit selbstverständlich auch mit einem starken Bezug zum Holzbau, den wir hier am Institut haben und der mittlerweile auch in meinem Büro eine wichtige Funktion hat. Und das Ganze in einer Richtung, in der das Konstruieren und das Entwerfen sehr eng verknüpft, sehr interdisziplinär gedacht werden. Da kommen selbstverständlich wieder die Dinge und die Entwurfstools vor, die ich gelernt habe, und auch der Ansatz, dass man alles, was man konstruiert auch mit Visualisierungen kontrolliert – zum Beispiel auch darauf hin, wie sie aus dem Augpunkt einer Person wirken. Also nicht der Blick von oben auf das Modell, sondern der Blick des Menschen als perspektivische Darstellung. Das Entwerfen mit Bildern ist etwas, das aus meiner Zeit an der ETH kommt, und das ich hier auch sicher als prägendes Arbeitsmittel einführen möchte. Mit allem was dazugehört. Wichtig bleibt aber auch die Arbeit, die das Institut jetzt macht und schon gemacht hat, es sind ja tolle Dinge, die hier schon da sind – und dass man das weiterführt und in etwas Neues überführt.
GAM: Wird der kulturelle und architektonische Kontext der Schweiz, der dich ja stark geprägt hat, in deine Arbeit an der TU Graz einfließen? Wenn ja, auf welche Weise?
LI: Natürlich, klar. Ich bin natürlich geprägt von der schweizerischen Architektur. Und ich mache schweizerische Architektur, das ist meine Grundlage. Jetzt ist es aber schon so, dass hier am Institut auch Nicht-Schweizer*innen arbeiten, die ihre eigene Erfahrungswelt haben, auf die ich auch sehr gespannt bin und die ich natürlich ein bisschen zusammenbringen möchte mit meiner Welt. Tatsächlich gibt es ja auch eine reiche Geschichte der Architektur hier in Graz, auf die ich sehr gespannt bin und ich bin auch schon dran, ein bisschen davon zu entdecken.
GAM: Gibt es schon Überlegungen, in welche Richtung du Forschung hier am Institut betreiben möchtest?
LI: Ja, es gab hier ein Forschungsprojekt, das gerade abgeschlossen wurde, „Circular Standards“, das finde ich ein fantastisches Projekt. Die Idee war, dass man versucht, einen Detailkatalog zu entwickeln, der zirkulär funktioniert. Obwohl das Projekt jetzt abgeschlossen ist, würde ich es gerne wieder aufnehmen, weiterführen und erweitern, vielleicht auch größer machen. Das Ziel könnte sein, dass es ein Standardwerk wird, so dass man im Büro sagt: jetzt schauen wir hier einmal nach, wie man’s macht. Da kann natürlich die Universität eine wichtige Rolle einnehmen zwischen Praxis und Forschung. Solche zirkulären Details oder Konstruktionen zu entwickeln, die im Idealfall im Einklang mit den Normen sind – die ja immer mehr, immer komplexer werden – das macht die Industrie nicht. Das Ganze, also die Norm und die Nachhaltigkeit und die Zirkularität, zusammendenken, das macht man in der Praxis anhand von Teilaspekten. Das machen aber oft kleine Büros, und als kleines Büro kannst du das unmöglich systematisieren. Ich sehe eine Uni wie die TU Graz und das Institut als Mittelstelle, die diese Praxiserfahrung sammeln und systematisieren kann und das zusammen mit der Industrie zu etwas führen, was die Industrie alleine nicht leisten will und die Praxis alleine nicht leisten kann. Das wäre für mich ein Ziel einer Forschungsabteilung wie der des IATs. Sonst interessiert mich in der Forschung ein Ansatz des einfachen Bauens, des Vereinfachens. Planen und Bauen wird immer komplexer, wir verlieren auch Kompetenzen als Architekt*innen, und ich denke, man müsste da wieder in eine Richtung gehen, wo es wieder etwas simpler, einfacher wird. Auch die Haustechnik sollte einfacher, dadurch auch dauerhafter, reparierbarer, zirkulärer, umnutzbarer werden. Möglichst wenig hochspezifische Bauteile und Schichtaufbauten, sondern möglichst simple Dinge, die man einfach herstellt, einfach repariert. In diese Richtung arbeitet Florian Nagler an der TU München. Das „Einfach Bauen“ ist etwas, das ich mir als Leitlinie für das IAT gut vorstellen kann, ohne dass ich das jetzt bereits in ein Lehr- und Forschungskonzept übersetzt hätte.
GAM: Du hast die Professur am Institut für Architekturtechnologie inne, wie verstehst du diesen Institutsnamen, oder sagen wir dessen inhaltlichen Fokus?
LI: Ich verstehe den Institutsnamen nicht und ich denke, den Begriff werde ich wohl umbenennen wollen. Denn der Begriff der „Technologie“ scheint mir nicht so richtig auf Architektur übertragbar zu sein. Das Institut hieß ja früher Hochbau und Entwurf, was ein bodenständiger Titel ist. Aber vielleicht würden wir es dann wegen der Kontinuität eher „Architektur und Technik“ nennen, auch damit man das Logo nicht neu machen muss. Aber den Begriff der Technologie würde ich lieber aus dem Namen des Instituts draußen haben. Und sonst verstehe ich das Institut oder die Aufgabe des Institutes, meine oder unsere Aufgabe darin, ein Entwurfslehrstuhl zu sein, der wie bei jedem Entwurf, den wir machen oder ich immer gemacht habe, einen sehr starken Bezug zum Bauen hat, zur Konstruktion, zum Ausführen. Auch wenn ich einsehe, dass es manchmal spannend ist, Entwürfe zu machen, die man nicht bauen kann oder will, ist das für mich nicht besonders interessant. Mich interessiert beim Entwerfen natürlich das Bauen und in der Architektur das Gebaute. Wie es altert, wie es benutzt wird, wie man es wahrnimmt, wie es umgebaut wird, wie es sich verhält, auch mit der Zeit, und auch wie man es einfach macht. Und ich verstehe es ganz klar als Entwurfslehrstuhl, es geht um Entwurf, aber der Entwurf hat einen starken Bezug zum Technischen, zum Bauen und zum Konstruieren.
GAM: Hier an der Fakultät wird Entwerfen als Schwerpunkt auch an anderen Instituten unterrichtet. Wie können sich die Studierenden zukünftig den pädagogischen Ansatz am IAT vorstellen?
LI: Zuerst muss man zwei Dinge sagen, erstens, dass ich in meinem ersten Semester noch keine Lehrverpflichtung habe und die Schwerpunkte auch noch ein bisschen entwickeln werde und möchte. Dann muss ich auch sagen, dass ich Assistierende habe, die viel Lehrerfahrung haben. Ich möchte ihnen auch so wenig wie möglich vorschreiben, wie sie es machen sollen, weil sie auch selber schon vieles können und gut sind. Aber dann wird es in die Richtung gehen, dass das Entwerfen interdisziplinär gedacht wird, stark geprägt von der Technik des Bauens und auch von der Haustechnik, von den Gedanken der Einfachheit, Zirkularität, Simplizität, Dauerhaftigkeit und, auch was die Konstruktion betrifft, mit einem starken Bezug zur Tradition. Fast immer, wenn wir etwas Neues erfinden, finden wir eigentlich nur etwas Altes wieder – und dieses Erfinden als Wiederfinden von etwas Bestehendem, das man dann selbstverständlich adaptiert, das interessiert mich. Selbstverständlich verschließt man sich nicht den neuen Entwicklungen, den neuen Anforderungen, es gibt neue Materialien, das ist klar. Aber es gibt eben auch alte Materialien, die in hohem Maße leistungsfähig sind, wie etwa Holz, bei dem man weiß, wie man es verarbeitet. Ich habe im Berufungsvortrag das Beispiel eines großen Holzträgers gezeigt, den man heute verleimt bestellt und dann hat er Leim drinnen, dann kannst du ihn kaum mehr weiternutzen und nicht so einfach verbrennen. Man braucht relativ viel Energie in der Herstellung, schon nur der Transport des Holzes ins Leimwerk – da haben wir versucht herauszufinden: Wie kann man zwei normale Holzbalken ohne Leim aufeinander positionieren, so dass sie kraftschlüssig sind? Man kann sie gegen das Verrutschen sichern mit Keilen oder mit einem Sägezahnschnitt und dann sind sie kraftschlüssig verbunden. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht und dann in der Literatur und bei alten Häusern geschaut und gesehen, das wurde ja vor 300 Jahren schon so gemacht. Das meine ich.
GAM: Die altbewährten Methoden also neu denken…
LI: Genau, das was es schon gibt, wieder entdecken und punktuell und spezifisch mit etwas Neuem ergänzen. Dort, wo es geht, ohne Leim in bewährter Manier arbeiten und wenn es nicht anders geht, dann macht man es dann verleimt. Aber wenn es geht, machen wir es so, wie man es immer gemacht hat, das ist dann sortenrein und man braucht dafür nichts als einen Holzstamm, den man zuschneidet.
GAM: Danke für das Gespräch!