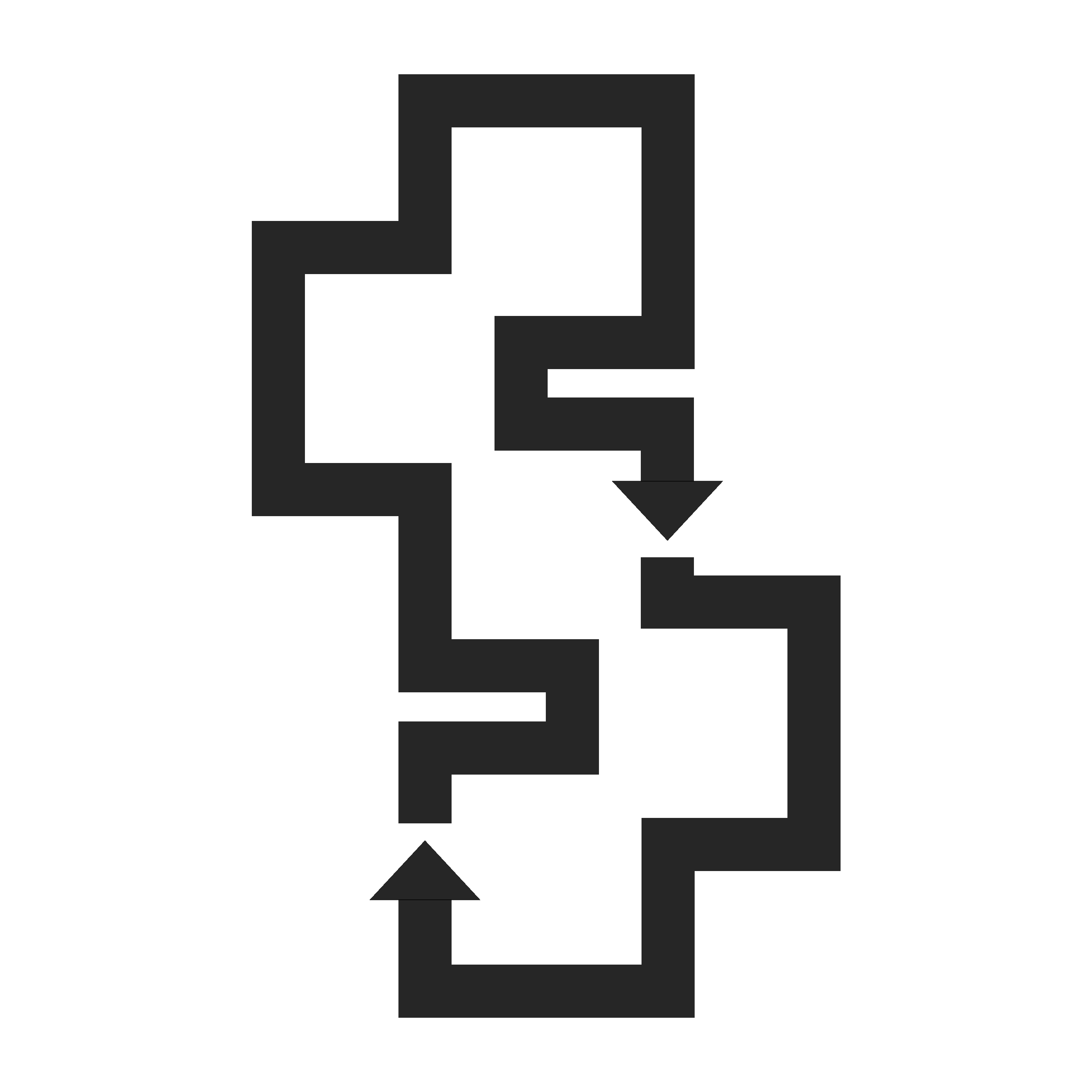Fakultätsnachrichten
GAD Awards 24
17.10.2024
Sebastian Stubenrauch, Xhylferije Kryeziu, Stefanie Obermayer, Carola Elisabeth Hilgert und Felix Dokonal sind die Preisträger*innen der diesjährigen Grazer Architektur Diplompreise. Die prämierten Projekte entwerfen neue Fassadenkonturen für ungenutzte Flächen (Sebastian Stubenrauch), beleuchten…
mehr
Welcome Guide | E-Book
23.09.2024
Die Fakultät für Architektur präsentiert den Welcome Guide – eine Broschüre, die sich an internationale Studierende und Studienanfänger*innen richtet, um ihnen den Einstieg ins Studium und die Orientierung auf dem Campus zu erleichtern.
mehr
Graz Open Architecture 2024
26.07.2024
Im Rahmen von Graz Open Architecture versammelte die Fakultät für Architektur verschiedene Ausstellungen der 13 Institute, studentischen Kollektive und Zeichensäle auf dem Universitätscampus. Neben der Präsentation zahlreicher Studierendenarbeiten und -projekte aus dem Bachelor- und Masterstudium in…
mehr
PHD DAY | Sommersemester 2024
03.07.2024
Im Rahmen der Doctoral School Architektur fand am 3. Juli der zweite PHD-Day des Jahres 2024 statt, der diesmal vom Institut für Architekturtechnologie unter der Leitung von Matthias Lang-Raudaschl organisiert wurde. Sieben Dissertant*innen präsentierten die zentralen Forschungsfragen und Methoden…
mehr
20 Jahre GAM – Graz Architecture Magazine
06.05.2024
Mit Erscheinen von GAM20 "The Infraordinary", gastredaktionell betreut von Matthias Castorph und Julian Müller, feierten Mitglieder der Fakultät am 6. Mai 2024 auch das 20. Jubiläum des GAM – Graz Architecture Magazine im Filmzentrum im Rechbauerkino. GAM-Chefredakteur Daniel Gethmann führte durch…
mehr
Graz Architecture Lectures 2024 – "Celebrating Collectivity!"
16.04.2024
Die diesjährigen Graz Architecture Lectures, die von Aglaée Degros (Institut für Städtebau) und Klaus K. Loenhart (Institut für Architektur und Landschaft) konzipiert wurden, motivierten zum Verlassen der eigenen Komfortzone, um sich aus der Kraft des Kollektivs den gegenwärtigen gesellschaftlichen…
mehr
PHD Day | Wintersemester 2024
05.02.2024
Im Rahmen der Doctoral School Architektur fand am 05. Februar der erste PHD-Day 2024 statt. Die Veranstaltung wurde von Matthias Castorph und Svenja Hollstein (Institut für Entwerfen im Bestand und Denkmalpflege) geleitet und organisiert. Insgesamt wurden 15 laufende Dissertationen präsentiert und…
mehr
„Stadt, Anger, Fluss“. Herbert Eichholzer Architekturförderungspreise 2023
23.11.2023
Das diesjährige Wettbewerbsthema der Herbert Eichholzer Architekturförderungspreise widmete sich unter dem Titel „Stadt, Anger, Fluss: Erinnerungskultur und Zukunft am Grünanger“ der Entwicklung. . .
mehr
Ehrung Barbara Herz
13.11.2023
Barbara Herz, ehemalige Leiterin des Dekanats für Architektur und Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen der Technischen Universität Graz, wurde am 6. November 2023 mit der Erzherzog Johann Medaille ausgezeichnet. Mit dieser Ehrung, von TU Graz Rektor Horst Bischof,…
mehr
GAD Awards 23
19.10.2023
Im Rahmen der Grazer Architektur Diplompreise (GAD Awards) werden jährlich die besten Abschlussarbeiten der Fakultät für Architektur aus dem letzten Studienjahr ausgezeichnet. Dieses Jahr war das Institut für Raumgestaltung unter der Leitung von Alex Lehnerer mit der Auswahl der Jury sowie der…
mehr