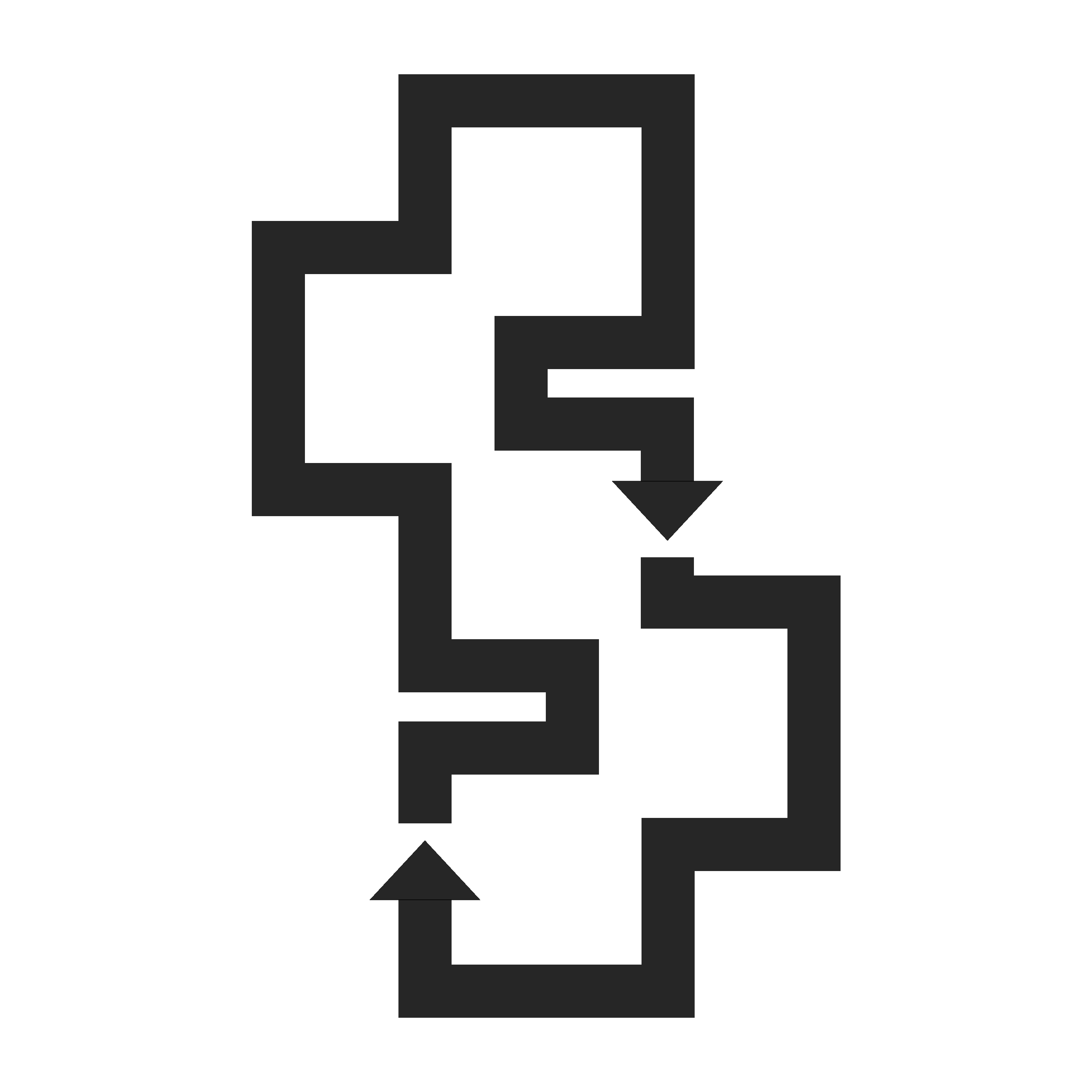BAUKULTURENTWERFEN
Petra Simon und Elemer Ploder (epps Architekten)
im Gespräch mit Petra Eckhard (GAM)
Mit der von epps Architekten im WS 2019/2020 angebotenen Lehrveranstaltung wird Bauen im Bestand als Entwerfen auf die Agenda des Instituts für Stadt- und Baugeschichte gesetzt. Im Interview sprechen Petra Simon und Elemer Ploder von epps Architekten über die Bedeutung der Baukultur als Chance für den Klimaschutz und erklären, inwieweit unkalkulierbare Risiken ein zentraler Bestandteil ihrer architektonischen Praxis sind.
GAM: Mit Eurem Grazer Büro epps Architekten widmet Ihr Euch seit 2005 vorwiegend dem Bauen im Bestand. Was macht den Bestand in Graz so besonders?
PS: Was Graz besonders macht, ist zum einen die Grazer Innenstadt mit ihrer vielfältigen historischen Präsenz, die ja auch zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Graz hat eine sehr spezielle regionale Identität. Blickt man zurück in die jüngere Grazer Baugeschichte, so ist die „Grazer Schule“, mit den Bauten von Günther Domenig, Eilfried Huth oder Szyszkowitz + Kowalski sicher ein lokales und besonderes Phänomen.
Und, Graz ist eine Stadt, die nicht primär vom Tourismus bestimmt wird. In Städten wie Salzburg oder Wien, zum Beispiel, ist der Stadtkern vorwiegend touristisch geprägt. In Wien wird darüber nachgedacht, wie man für das zahlungskräftige Touristen-Klientel baut. Das ist in Graz nicht so. Die GrazerInnen haben sich ihre Stadt und ihr Stadtzentrum behalten. Das drückt sich auch in den informellen Zonen, wie z.B. dem Kaiser-Josef-Platz aus. Während er tagsüber die Funktion eines Bauernmarkts erfüllt, zieht er abends die unterschiedlichsten Menschen an, die sich dort in und um die verschiedenen Lokale versammeln. Dort wird beispielsweise spontan zwischen den Standln ein Teppich aufgelegt und Musik gemacht. Die StudentInnen sitzen neben den Menschen in schicken Sakkos und neben den Kreativen der Stadt, und alle hören den Musikern zu. In Graz gibt es noch informelle Zonen, die nicht organisiert sind. Die Bevölkerung hat sich diesen Marktplatz also angeeignet, das finde ich großartig.
GAM: Warum ist Bauen im Bestand so wichtig weiterentwickelt zu werden?
PS: Es macht deshalb Sinn, weil es um die Aufgaben der Gegenwart und vor allem der Zukunft geht, die zu bewältigen sind. Wenn es um Fragen oder Strategien zur Demographie und zum Klimawandel geht, sind aktuell der Bausektor, die Stadtplanung und die Stadtentwicklung viel zu wenig eingebunden. Wir denken darüber nach, ob wir lieber mit dem Flugzeug oder mit dem Segelboot nach New York reisen sollen, aber welche Mengen an Ressourcen wir im Bausektor verbrauchen, d.h. an freien Flächen oder an grüner Wiese, ist aus meiner Sicht noch nicht ausreichend präsent.
EP: Das resultiert auch daraus, dass die Frage der Baukultur immer weiter zurückgedrängt wird und Bauen vermehrt zu einer Frage des Investments geworden ist. Natürlich sagt der Investor bzw. die Investorin: „Mit einem Neubau habe ich weniger Risiko, er ist kalkulierbar und mein Budget ist gesichert.“ Deswegen ist von Seiten der InvestorInnen die grüne Wiese als Ausgangssituation immer beliebter als der Bestand. Diese Strategie wird aber in Zukunft weder ökologisch noch ökonomisch Erfolg haben. Die Frage der Identitätsbestimmung bleibt bei der Errichtung großer Neubauprojekte meist auf der Strecke.
PS: Ich bin der Meinung, dass alle Städte der Zukunft ein vernünftiges Bestandsmanagment brauchen. Dem Thema Leerstand muss eine größere Bedeutung beigemessen werden. Beispielsweise behauptet Lamia Messari-Becker, Professorin für Bautechnologie an der Uni Siegen: „Deutschland ist gebaut.“ Folglich wird das Planen und Bauen im Bestand das Berufsbild der ArchitektInnen noch intensiver prägen. Deshalb ist die Auseinandersetzung und der Umgang mit Beständen in städtebaulicher, gesellschaftlicher, denkmalpflegerischer und nutzungsrelevanter Hinsicht vor allem für Studierende enorm wichtig. Auch den damit verbundenen komplexeren bautechnischen Themen muss in der Ausbildung ausreichend Raum gegeben werden.
GAM: Eure Lehrveranstaltung im Wintersemester 2019/20 wird sich inhaltlich mit der Gestaltung der Grazer Spielstätten beschäftigen. Wie seid Ihr auf das Thema gekommen und welche Ziele verfolgt der Entwurfskurs?
PS: Es ist ein anspruchsvolles Thema, denn man setzt sich dabei mit Theaterraum, Bühnenbild und den Inszenierungen auseinander. Dazu liefern Theaterstücke ja auch immer gesellschaftspolitische Aussagen. Architektonisch relevant ist die Spielstätte als Kulturbau aber auch als ein Raum, der ständig im Umbau ist, in dem ständig neue Welten kreiert werden. Wir werden uns im Master Studio mit dem Grazer Schauspielhaus und den Kasematten am Schlossberg auseinandersetzen. Wir haben im Vorfeld mit dem Geschäftsführer der Grazer Spielstätten darüber gesprochen, welche Adaptierungen erwünscht sind. Das Ziel bei dem Kasematten-Projekt, beispielsweise, ist eine Ergänzung der Schlossbergbühne um eine klare Zugangssituation mit Kassenbereich und Garderobe. Für diese Nutzung sollen die Studierenden einen kontextbezogenen Raum entwerfen. Das heißt, sie sollen sich bei ihren Entwürfen überlegen, welche Form diese Addition haben soll, ob sie temporär oder permanent sein soll, und welche Beziehung sie zum gebauten Kontext, also, zum Beispiel, zur alten Festungsmauer herstellen kann. Wir kennen den Bestand bereits sehr gut, da wir am letzten Umbau beteiligt waren und den Witterungsschutz im hinteren Teil neben der Bühne entworfen haben.
EP: Beim Schauspielhaus wollen wir der Probebühne eine neue Rolle im Haus zuschreiben und sie aus ihrem Versteck im vierten Obergschoß des Gebäudes locken. Einerseits aus der Notwendigkeit heraus, die Fluchtwegsituation zu verbessern, und andererseits, um dem introvertierten Status des Schauspielhauses und vor allem der Probebühne eine neue physische Präsenz zu verleihen. Damit können wir das Theater der Öffentlichkeit näher bringen. Dabei soll die Fläche vor dem Gebäude, die aktuell als Parkplatz genutzt wird und die bis zur Grazer Burg reicht, für eine architektonische Ergänzung zur Verfügung stehen. In diesem Bereich können die Studierenden unterschiedliche Entwurfsansätze gestalterisch erproben. In dem neuen Gebäude sollen eine Kostümschneiderei sowie Lagerflächen untergebracht werden. Das heißt die Aufgabenstellung wird lauten, das bestehende Schauspielhaus mit einem neuen Raumprogramm zu verknüpfen, d.h. neue Anschlusspunkte zu generieren und den Bestand räumlich neu zu organisieren.
GAM: Welchen Stellenwert haben dabei Bauforschung und Denkmalpflege? Inwieweit fließen diese Disziplinen in Eure Lehrmethoden mit ein?
PS: Wir werden mit den Studierenden vor allem Kontextanalysen betreiben. Das heißt, wir haben zunächst die Einbettung des Schauspielhauses in den städtebaulichen Kontext, also in die benachbarte innerstädtische Infrastruktur wie den Freiheitsplatz, den Grazer Dom, oder die markante Achse der Bürgergasse. Da muss man zum Beispiel über Blickbeziehungen nachdenken oder darüber, wie sich das Gebäude in die für Graz so besondere Dachlandschaft einfügt. Dann gibt es auch den historischen Kontext des Gebäudes selbst, mit seiner bewegten Geschichte und der Bedeutung für die Stadt. Wir werden analysieren, wie sich das Schauspielhaus historisch entwickelt hat und warum es sich so entwickelt hat. Letztendlich geht es dann auch um Materialitäten, die dort bereits vorhanden sind. Oder darum, wie sich gewisse Gliederungen in der Fassade fortsetzen. Wir fragen: „Was war, was ist, und was wird gebraucht?“
EP: Uns ist aber auch wichtig, dass sich die Studierenden direkt mit dem Denkmalamt auseinandersetzen. Es gilt natürlich, die Anliegen und Forderungen des Denkmalschutzes im Entwurf zu berücksichtigen. Wir konnten für die Lehrveranstaltung auch Christian Brugger, den Leiter des Bundesdenkmalamts für Steiermark gewinnen, der mit den Studierenden einen denkmalgerechten Umgang mit dem Bestand diskutieren und erarbeiten wird. Wir haben auch einen Bauherren, der seine Vorstellungen ebenfalls miteinbringen wird. Die Studierenden werden im Entwurfsprozess auch von DramaturgInnen und SchauspielerInnen begleitet, damit das Resultat für die NutzerInnen ein funktionaler Mechanismus wird. Dadurch wollen wir veranschaulichen, dass Bauen im Bestand immer interdisziplinäres Arbeiten und Arbeiten im Team bedeutet.
GAM: Mit dem Schutz und Erhalt historischer Bausubstanz ist man meist mit architektonischen Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert, die im Neubau keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen. Wie erlebt Ihr das Spannungsfeld zwischen formal-ästhetischer Entwurfsarbeit und denkmalschutzrechtlichen Vorschriften?
PS: Das Spannungsfeld ergibt sich allein schon dadurch, dass wir uns als ArchitektInnen in erster Linie mit dem Errichten von Bauwerken und dem Schaffen von Raum beschäftigen und sich der Denkmalpfleger bzw. die Denkmalpflegerin mit dem Schutz vorhandener Bausubstanz beschäftigt. Das ist aber gleichzeitig ein spannender Dialog, und beide Ansätze haben ihre Berechtigung. Gerade im fachlichen Austausch kann man zu einem guten Ergebnis kommen. Auf den Kasematten zum Beispiel, muss der Architekt bzw. die Architektin im Dialog mit dem Naturschutz, mit einem Ornithologen, der Altstadtsachverständigenkommission, dem Denkmalamt und mit dem Bauamt zusammenarbeiten. Das sind viele verschiedene Projektbeteiligte mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Vorgaben. Unsere Aufgabe ist es, alle diese Parameter in Einklang zu bringen. Und das kann natürlich fordernd sein.
EP: Und sobald man im Umbau tätig ist, kommt es meist anders als man denkt. Man muss mit Unvorhergesehenem umgehen können. Wir haben einmal an einem Projekt gearbeitet, bei dem sich im Zuge des Baufortschritts herausgestellt hat, dass der Bestand über kein herkömmliches Fundament verfügte. Die tragenden Außenwände waren auf Steinplatten errichtet worden und endeten einen halben Meter unter dem Boden. Das hat dann alle ein wenig nervös gemacht.
GAM: Welches Projekt war für Euch die größte Herausforderung?
EP: Herausfordernd war zum Beispiel ein Aufzugseinbau in einem historischen Innenhof mit einem freistehenden barocken Stiegenhaus, das natürlich denkmalgeschützt war, und in dem ein barrierefreier Zugang gewährleistet werden sollte. Wir mussten also mit der Altstadtkommission und dem Denkmalschutzamt lange darüber reden, wo dieser Aufzug in dieser ohnehin sehr beengten Raumsituation am besten integriert werden kann. Zudem mussten wir uns mit Fragen der Materialität in Bezug auf den historischen Bestand beschäftigen. Wir haben die Konstruktion dann so ausgelegt, dass das Technoide des Neuen durch eine Referenz an den Barock, in Form eines rautenförmigen Ornaments an der Liftfassade, in den Hintergrund tritt.
GAM: Welches zeitgenössisches Bauen-im-Bestand-Projekt betritt Eurer Meinung nach gegenwärtig Neuland?
EP: Wer gegenwärtig sehr gut mit diesem Thema umgeht ist David Chipperfield. Mit dem Wiederaufbau des Neuen Museums auf der Berliner Museumsinsel zeigt er, dass man nicht alles immer aufpolieren muss und etwas auch alt sein darf. Er bringt es zustande, das Vergangene durch Intervention zu stärken und gegenwärtig zu machen, wie zum Beispiel bei der Treppenanlage im Neuen Museum. Die Treppen wurden in Lage und Form wieder neu aufgebaut, aber nicht in der ursprünglichen Materialität. Chipperfield schafft es, auf unaufgeregte Weise alte Funktionen respektvoll mit neuen Mitteln zu denken, und das, ohne den Bestand dabei zu schwächen.
GAM: In Eurem Leitbild heißt es: „Architektur soll nicht nur nützen, sondern auch ‚sprechen‘.“ Welche Botschaften von Architektur haben Euch bereits zu denken gegeben?
PS: Ich denke oft über die Botschaften nach, die uns die zunehmend globalisierte Architektur vermittelt. Also Architektur, die vom Kapitalismus geprägt ist und die in ihrer Bedeutung auf eine Immobilie reduziert wird. Sind die Business Districts dieser Welt nicht alle austauschbar? Da wird ja nicht billiger Ramsch gebaut. Weltweit entstehen Architekturikonen, die einen reinen Marketingauftrag zu erfüllen haben. Architekturbüros sind aber auch Dienstleistungsunternehmen, die mit AuftraggeberInnen arbeiten, die erwarten, dass ihre Wünsche, Bedürfnisse und Programme in Architektur übersetzt werden. Wir sind also nur Teil der Lösung oder des Problems.
EP: Schwierige Frage. Grundsätzlich denke ich oft unabhängig von der Qualität der Architektur über den Prozess des Entstehens nach. Wieso ist ein Gebäude beliebig, wieso ist ein anderes besonders? Woraus hat sich seine Form entwickelt? Auch die Materialitätsfindung interessiert mich. Ich versuche, mir die Botschaften von Architektur zu erklären. Nachdem wir aktuell das Thema Spielstätten im Fokus haben, möchte ich als Beispiel die gefaltete Überdachung am Hintereingang des Grazer Schauspielhauses nennen, die mich beim Passieren des Gebäudes immer wieder auf’s Neue beschäftigt. Wie hier die schwierigen funktionalen und technischen Anforderungen das gestalterische Ergebnis positiv bestimmt haben, beeindruckt mich. Wen wundert es, dass diese raffinierte Konstruktion aus jüngerer Zeit denkmalgeschützt ist.
GAM: Herzlichen Dank für’s Gespräch.
Link zu den Lehrveranstaltungen: Bauen im Denkmal | Entwerfen 3